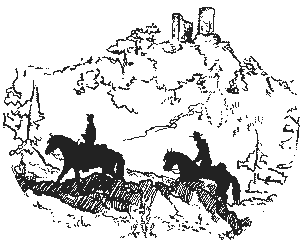
|
TAUNUSREITER
(c) Frank Mechelhoff 2012 - Kopien
speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig
Siehe Copyright-und
Kontakt-Hinweise
Neu
9. Feb. 2014 / Update Feb. 2017
|

Windräder im Vogelsberg auf Grünland: Hier wirken sie auf den
Betrachter nicht störend, sondern landschaftsbereichernd (Windpark
Hartmannshain)
Im Wald ist das etwas ganz anderes.
Die Märchen und Mythen rund um die
Windenergie
- Die Wirtschaftlichkeit der
Anlagen und die Idee einer "Strom-Selbstversorgung"
- Mit Windrädern können Anleger leicht
Geld verdienen
- Wieviel Wald muß gerodet werden?
- Wie werden die Anlagen nach der
Betriebsdauer zurückgebaut?
- Windanlagen und deren
"umweltschonende" Errichtung und Betrieb
- Schutz der Verkehrswege
- Schwarzstorch und Rotmilan sind
geschützt - was ist mit dem Menschen?
- Das Märchen um politische Transparenz
und Bürgerwillen bei Großprojekten
- Anmerkungen
|
Aus der Mühle schaut der
Müller, der so gerne mahlen will.
Stiller wird der Wind und stiller, und die
Mühle stehet still.
So gehts immer, wie ich finde, Ruft der Müller
voller Zorn.
Hat man Korn, so fehlts am Winde, Hat man Wind,
so fehlt das Korn..!
Wilhelm Busch (1832 - 1908)
|
Märchen 1: Die
Wirtschaftlichkeit der Anlagen und die "Strom-Selbstversorgung"
Wo es ja offenkundig nur um's Geld geht, kann man die Frage ja
ruhig stellen: Was kommt denn nun heraus bei dem ganzen Aufwand?
Als erstes wird immer gen damit geworben, für wieviel Haushalte
denn Strom produziert werden könnte. Da soll dann ein geplanter
Windpark, wie z.B. Neu-Anspach 35 Mio KWh im Jahr
liefern, also den Strombedarf von 10.000 Haushalten decken.
Wie kann man da noch gegen die Anlagen sein, wo Neu-Anspach etwa
8.000 Haushalte hat? Wer gegen diese Anlagen ist, der muss wohl
für Atomkraft sein, oder ist ein Leugner des Klimawandels...? Doch
ganz so einfach ist die Sache leider nicht!
Allein die Gleichsetzung 35 Mio KWh = 10.000 Haushalte (weil 3.500
KWh= statistischer Jahresverbrauch eines deutschen Haushalts) ist
eine an Volksverdummung grenzende Milchmädchenrechnung.
Denn der Strom wird ja nicht produziert wird, wenn die Haushalte
ihn benötigen, sondern irgendwann, wenn der Wind weht. Die
10.000 Haushalte, die die Windräder vor der Haustür stehen haben,
für die der Strom also angeblich produziert wird, haben aber
nichts davon, im Gegenteil: Sie müssen über ihre Stromrechnung die
Ökostrom-Einspeisevergütung bezahlen, und zusätzlich den
Strom alter Kohlekraftanlagen kaufen, weil bei der
subventionierten Fehlsteuerung der Investitionsgelder für
Windkraft kein Geld mehr da ist, um moderne umweltfreundliche
Gaskraftwerke zu bauen, die man immer dann benötigt wenn mal kein
Wind weht.
Zweitens: Auch die angesagten 35 Mio KWh beruhen auf völlig unrealistischen
Annahmen, wie man durch einfache Division berechnen kann,
noch während der Bürgerinformationsveranstaltung, sobald man weiß
wie hoch die Nennleistung der geplanten Anlagen ist. Hier waren
z.B. 5 Anlagen (Typ Vestas 117) mit je 3.000KW (=3MW) - das sind
die stärksten Triebwerke die es derzeit für landgestützte Anlagen
gibt.
Es gilt:
|
Gesamtproduktion
|
=
|
Nennleistung je Anlage |
*
|
Anzahl der Anlagen
|
*
|
Volllaststundenzahl |
|
35.000.000 KWh
|
=
|
3.000 KW (3 MW)
|
*
|
5
|
*
|
2.333,3
|
Die Vollaststundenzahl in dieser Betrachtung ist eine
rechnerische Größe, die den prognostizierten Auslastungsgrad
einerAnlage angibt. Die tatsächlich erreichte Vollaststundenzahl
ist selbstverständlich windabhängig. Eine prognostizierte
Stromproduktion von 35 Mio KWh erfordert also, dass die Anlagen
2.333 Stunden im Jahr unter Vollast (oder 4.666 unter "halber
Last") laufen.
Laut Deutschem Windenergie-Institut in Wilhelmshaven
(DEWI)- Statisk werden aber in Süddeutschen Flächenbundesländern
leider nur zwischen 920-1300 Vollaststunden je
Anlage erreicht (Quelle1;
Quelle2)
. Da dass Jahr bekanntermaßen ca. 8.765 Stunden hat, kann also
evtl. nur mit wenig mehr als 10% Auslastungsgrad rechnen.
- Allein diese Zahl zeigt den technischen Irrsinn derartiger
Projekte. Die statistische Vollaststundenzahl je Windkraftanlage
- d.h. tatsächlich verkaufter Strom - ist laut dieser Statistik in
den letzten Jahren gesunken, obwohl man annehmen sollte
dass er dank der technischen Weiterentwicklung der Anlagen
(Schwachwindläufer) steigen sollte - warum wohl? Weil die
Windanlagen dank der Förderpolitik nun auch an Standorte gestellt
werden die sich von vornherein nicht rechnen. ***)
Im 2015 errichteten Windpark Weilrod lag der Stromertrag 9
Monaten nach Inbetriebnahme des Windparks 1/3 unter den
prognostizierten Erwartungen (hocherechnet 1.600 Vollaststunden
anstelle der geplanten 2.350), und das obwohl die
Durchschnitts-Windstärke genau dem erwarteten entspricht und 2015
als "gutes Windjahr" gilt.
Bezogen auf Neu-Anspach bedeutet
dies, das die Stromleistung der geplanten Anlagen wohl auch nur
bei 50% der prognostizierten 35 Mio KWh liegen könnte -
vielleicht sogar noch weniger. Denn wie jeder weiß, der hier wohnt
(aber vielleicht nicht jeder Projektentwickler von außerhalb) weht
der Wind im Taunus nicht gleichmäßig sondern ist eher böig. Jede
Windunregelmäßigkeit wird immer auf Kosten der Gesamteffizienz
gehen. Außerdem müssen die Anlagen auch aus Naturschutzgründen bei
Vogel- und Fledermauszug abgeschaltet werden.
Nun ist ja leicht vorstellbar, dass die produzierte Strommenge
erhebliche Wichtigkeit hat für das Finanzierungskonzept solcher
Anlagen. Deswegen auch das ganze Bohei um die jetzt durchgeführten
Windmessungen (Windmessmast) an den geplanten Standorten. Das
Problem dabei ist leider, dass eine Windmessung über wenige Monate
gar nicht statistisch relevant ist, dass sogar die
Jahreswindmengen stark unterschiedlich sind. Die Betreiber solcher
Anlagen bewegen sich mit derartigen Aussagen zur
Vollaststundenzahl also auf dünnstem Eis. Die Schwankungsbreite
ist derartig dass eigentlich überhaupt keine Ertragsprognosen
gemacht werden können die man als seriös bezeichnen könnte. Die
Banken wissen das auch, finanzieren aber trotzdem. Wahrscheinlich
rechnen sie damit, dass der Staat die Anlagenbetreiber schon nicht
pleitegehen lassen wird.
Die Idee der "Strom-Selbstversorgung" -
..leuchte Klein-Emma und Klein-Hand sofort als vernünftig ein, ist
aber ein Irrweg der direkt ins Mittelalter der Energieversorgung
führt. Da gab es übrigens auch schon eine Energieversorgung die nur
aus regenerativen Energiequellen bestand. Dort wo es keine Energie
gab, konnte man weder leben noch produzieren. Irgendwann wurden die
Städte immer größer und es gab die erste Industrie, und
selbstverständlich erzeugte man auch den ersten Strom jeweils nur
für den lokalen Verbrauch. Vor über 100 Jahren wurden dann die
Verbundnetze eingeführt, weil die Stromversorgung der Industrie- und
dichbesiedelten Regionen anders nicht zu bewerkstelligen war. Diese
müssen (zur Nutzung der Offshore-Windanlagen im Meer) heute sogar
noch erweitert werden. Somit besteht keine Notwendigkeit einen
Großteil der Energie lokal zu erzeugen. Es spräche, in
strukturschwachen Regionen mit genügend Wind, nichts dagegen, wenn
man große Mengen produzierten Stroms zu marktfähigen Kosten und
verlustarm speichern könnte. Doch dies ist ein ungelöstes
Problem, obwohl daran schon lange geforscht wird. Derzeitige
Prototypen-Anlagen (z.B. EE-Gas) sind
teuer und mit Verlustraten von 50% oder mehr behaftet. Was
bedeutet, es würde die doppelte Anzahl Windräder benötigt,
wie schon prognostiziert. Außerdem würde der "saubere Strom" am Ende
doch verbrannt (wie bei einer modernen Gasheizung). Das Speichern
mit Pumpkraftwerken wäre effizienter, scheitert aber am immensen
Platzbedarf und den Kosten solcher Anlagen (derzeit gibt es 35; es
wären aber mindestens 500 erforderlich, für die es keine Standorte
gibt). Eine Weiterentwicklung dieser, bereits ausgereiften Technik
ist nicht zu erwarten.
"Unser Windpark ?"
Wem gehören denn die Anlagen, in denen "unser" Strom
produziert wird? Die Windräder sollen in den Wald vor unserer Tür,
aber wem gehören sie? Den Gemeinden? Nein. Neu-Anspach wird nicht
etwa Eigentümer und Betreiber dieser Anlagen (wie die
Stadt Ullrichstein im Vogelsberg, die ihren Windpark selbst
finanziert hat). Dazu sind diese finanziell viel zu klamm. Der
Stadt Neu-Anspach gehören die Waldparzellen, auf denen die
Windräder stehen sollen, dafür kassieren sie vom Anlageneigner
eine Pacht. Nur darum geht es. Dem Vernehmen nach
(natürlich sind diese Zahlen "Geschäftsgeheimnis"...!) im Falle
von Neu-Anspach 300.000 € pro Jahr - vermutlich aber nur
wenn die unrealistische Zielvorgabe der 35 Mio KWh erreicht
werden, sonst wohl weniger. Die Details der Verträge werden sicher
nicht ohne Grund geheim gehalten (vgl. unten "Märchen:
Transparenz").
Was steht dagegen:
- die nicht wieder gut zu machende Zerstörung des
Erholungsgebiets (1000 LKW Ladungen Beton und Schotter in den
Wald)
- das Geräusch (40dB in 1.2km). Die großen Anlagen haben ein
tiefes Brummen, auch Infraschall ist ein Thema. Was ist mit der
Nachtruhe? Was ist mit der Ruhe im Wald? Was hebt uns noch von
anderen Gegenden wie dem RheinMain-Gebiet ab, wenn wir das ohne
Not aufgeben?
- der ganz sicher eintreffende Wertverlust der Wohnimmobilien in
Neu-Anspach und Schmitten. Immobilien sind hier hochpreisig.
Dafür haben die Käufer bestimmte Erwartungshaltungen, und wollen
ganz sicher keinen vermeidbaren Lärm hinnehmen. Vom Wertverlust
werden hauptsächlich jene betroffen sein, die in der jüngeren
Vergangenheit in den betroffenen Gebieten Wohnhäuser gebaut oder
gekauft haben. Sie haben nun vielleicht einen Kredit über
400.000 € laufen, und das Haus ist plötzlich nur noch für
300.000, wenn überhaupt, zu verkaufen.
- Die letztendliche Verantwortung für die Entsorgung/ Abbau der
Anlagen liegt auch beim Grundstückseigentümer. Das Risiko, auf
den Kosten der Ruinen am Ende sitzen zu bleiben, ist also hoch,
trotz aller Absicherungen und Bürgschaften. Man kann sicher
gehen, dass Gemeinden oder Landesforsten als Grundeigentümer
niemals die Mittel aufbringen werden, um die Anlagen zu
entsorgen, falls die Anlagenbetreiber pleite gehen oder den
Abbau der Anlagen schlicht verweigern.
Ich frage mich: Sind 100.000-300.000,-
pro Jahr Pachteinnahmen in der Gemeindekasse diese Nachteile wert?
Tut der Wald nicht schon genug für uns und die
Energiewende, indem er mit CO2-neutral produziertem Brennholz uns
den Arsch warm macht? Der Gemeinde als Waldbesitzerin Geld in die
Kassen spült durch den Holzverkauf? Ist es wirklich nötig, ihn
zusätzlich noch in ein Industriegebiet zu verwandeln..?
Märchen 2: Mit Windrädern können Anleger
gutes Geld verdienen
Wer kann an den Anlagen verdienen, bzw. wer
verdient zuerst bzw. das meiste Geld? Vereinfacht gesagt: Wenn
Anlagen wirtschaftlich sind, wird das Geld in dieser Reihenfolge
verteilt:
- Die Banken für die Fremdkapitalzinsen,
mit denen die Windparks finanziert werden
- Die Anlagenbauer, Aufsteller und
Servicefirmen,
- Die Projektentwicklungsfirmen und
Windradplaner
- Die Anlagenbetreiber (Energiekonzerne)
- Die Anleger, die ihr Eigenkapital in die
Anlagen stecken
Die Kapitalgeber (Kleininvestoren) stehen
somit als letzte in der Schlange, wenn Profit zu verteilen ist.
Geht es der Firma nicht so gut, ist es umgekehrt: Dann ist ihr
Geld als erstes weg. Ihr Kapital ist meist über viele Jahre
gebunden und nicht rückholbar. Wenn sie nur in ein einzelnes Windrad
investiert haben, etwa in Genossenschaftsmodellen, müssen sie
damit rechnen dass genau dieses Windrad am häufigsten im
Windschatten steht oder kaputt geht. Was dem Geldanleger generell
empfohlen wird, sein Kapital zu streuen um Risiken zu verringern,
ist bei Geldanlage in Windenergie nur schlecht möglich. Die teuer
gedruckten Anlegerprospekte versprechen Renditen von 8% pro Jahr,
aber die Refinanzierung von Ausschüttungen ist oft intransparent,
der Vorwurf des "Schneeballsystems" steht im Raum. Wer investieren
will, sollte erstmal checken, wem der Laden wirklich gehört, und
wirkliches Geld verlieren würde falls der Laden pleite gehen
sollte. Die Stammkapitalgeber können einen Verlust von 25.000,-
meist gut verschmerzen weil sie vorher mit der Gutgläubigkeit der
Kleinanleger genug verdient haben, und gründen danach einfach eine
neue Firma.
Fazit: Ohne professionelle Anlageberater ist
es für den Anleger schier unmöglich, die guten Anlagen von den
schlechten zu unterscheiden. Die taz
warnte schon im Feb. 2010 und im Juli 2013
noch einmal vor der Vorstellung, Windparks seien eine "grüne,
sichere Geldanlage". Die meisten Anleger warten vergebens auf
Ausschüttungen und sind am Ende der Laufzeit froh, ihr Kapital
wiederzusehen. Nachdem die neue Bundesregierung die Subventionen
für die Windräder (aus gutem Grund) kürzen will, wird
es für die Anleger demnächst wohl noch trüber aussehen.
Märchen
3: Von der "erforderlichen Kranaufstellfläche"
Man braucht nur mal im Vogelsberg
nachzuschauen (am Ulrichsteiner Kreuz). Standort
zum Nachschauen hier! Da
steht ein neues Windrad auf einer Wiese, und die
geschotterte Aufstellfläche ist etwa 15x60m groß, d.h. nur
1/10 der Fläche die angeblich im Wald "benötigt" wird. Die
Kühe freuen sich, weil sie mehr Gras zu fressen haben, der
Bauer auch, sofern sein Pachtgeld dasselbe beträgt.
Märchen 4:
Vom Rückbau der Anlagen
Zunächst ein Stückchen Gesetzliche Grundlage:
"Rückbau ist
die Beseitigung der Anlage, welche der bisherigen
Nutzung diente und insoweit die Herstellung des
davor bestehenden Zustandes.
Zurückzubauen sind grundsätzlich alle
ober-und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (einschließlich
der vollständigen Fundamente) sowie die
zugehörigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze
und sonstige versiegelte Flächen."
Aber noch mehr als das wird verlangt: "Die durch die
Anlage bedingte Bodenversiegelung ist so zu beseitigen,
dass der Versiegelungseffekt, der zum Beispiel das
Versickern von Niederschlagswasser beeinträchtigt oder
behindert, nicht mehr besteht. Nach Abschluss der
Rückbaumaßnahmen ist sicherzustellen, dass der Standort
die natürlichen Bodenfunktionen und bisherigen
Nutzungsfunktionen wieder erfüllt. Zur Beseitigung
nachhaltiger Verdichtungen im Unterboden sind
entsprechende Maßnahmen (zum Beispiel Lockerung,
geeignete Folgenutzung) umzusetzen" (Hessischer
Staatsanzeiger 44/2011: Umsetzung der
bauplanungsrechtlichen Anforderungen zur
Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung nach § 35
Abs. 5 Satz 2 und 3 BauGB bei der Genehmigung von Wind
- energieanlagen im Außenbereich Gemeinsamer Erlass
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung und des Hessischen Ministeriums
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz).
Hierzu fallen mir drei, wirklich nur rhetorische, Fragen
ein: |
 |
1.) Kann man auf gut Behördendeutsch noch
deutlicher sagen, dass "kompletter Rückbau" wirklich "kompletter
Rückbau" bedeutet?
2.) Wie man den Beton in flüssiger Form in den Wald hinein
bekommt ist klar: 80-100 Lieferbeton-Lastwagen je Fundament.
Nur: wie bekommt man ihn in fester und armierter Form wieder
heraus? Dreieinhalbtausend Tonnen hochfeste
Betonfundamente metertief im Boden verankert "rückstandslos zurückgebaut"
-- außer vielleicht durch eine ebensolche Menge Dynamit? -
Dänen und Franzosen z.B. hätten damit gern die Fundamente
des großdeutschen Westwalls beseitigt, was aber mißlang. Zum
anderen ist damit der "davor bestehende Zustand" natürlich
auch nicht wieder herstellbar.
3.) Die in diesem Zusammenhang wichtigste Frage: Ist
angesichts solch glasklarer Vorgaben (Erlaß= hat
Gesetzeskraft für Mitarbeiter aller Behörden) die Genehmigung
derartiger Anlagen, ohne sauberen Nachweis des
Anlagenbauers wie ein solcher Rückbau durchzuführen ist (Machbarkeit
und Kostenübernahme), nicht eigentlich ein strafwürdiger Rechtsbruch??
Die verlangten Rückbaubürgschafte sind unter solchen
Umständen doch nicht einmal das Papier wert auf dem sie
möglicherweise stehen!
|

Bild links: Fundament eines Windrads komplett armiert und
verschalt kurz vor der Betonierung. Hochkonjunktur für
Eisenflechtereien und Gußbeton-Lieferanten!
Betonieren, da macht uns Deutschen so schnell keiner was
vor!
Haltbarkeit: Länger als der Römische Limes - Kommen Sie
in 1 Mio Jahren wieder!
|
Märchen 5:
Windräder können umweltschonend errichtet werden
Es ist richtig, 5.000, selbst 9.000qm oder 14.000qm ****) gefällte
Bäume sind in den meisten Nadelwald-Monokulturen erst mal keine
Katastrophe (es ist jedoch zu befürchten dass es nicht dabei bleibt,
besonders nach größeren Stürmen *) Auch die 15 Schwertransporte
für die Großbauteile je Windrad wären zu verkraften, wenn man
sie dazu nicht mehr als 500m durch den Wald fahren muss und
die Infrastruktur
an Transportwegen dazu bereits existiert. Das ist
jedoch meist nicht der Fall!
Wo je Windrad 200 LKW-Ladungen Schotter für die
"Ertüchtigung" der Transportwege, und Beton für das Fundament in den
Wald gekarrt werden muss - und davor durch die Dörfer der Umgebung -
das ist nicht nicht umweltfreundlich zu nennen. (Wir sind hier in
Hessen, wo man eben nicht für die US Army jeden Fahrweg
panzertauglich ausgebaut hat, wie in Hunsrück und Eifel). Was nicht
nach Betriebsende rückstandslos wieder entfernt werden kann, ist
nicht "umweltfreundlich" zu nennen. Das Thema "Öle und
Betriebsflüssigkeiten" ist noch gar nicht angesprochen worden.
Die mehrstöckig großen Maschinen benötigen Tonnen davon. Es ist doch
naiv anzunehmen, dass Wälder (unsere wichtigsten
Trinkwasserspeicher) durch diese niemals verunreinigt werden - nicht
im Regelbetrieb, und noch weniger im Havariefall.
Märchen 6:
Schutz der Verkehrswege
Für jeden Bauträger,
Bauherrn oder Betreiber einer Anlage ist der Schutz der
Verkehrswege verpflichtend, die an seinem Bau liegen.
Selbstverständlich sind auch eifrig begangene Wanderwege wie die
Rennstraße solche Verkehrswege. Die typischen Risiken im
Wald sind recht überschaubar geworden. Obwohl einem da auch ein
Ast auf den Kopf fallen kann, ist man zumindest als Fußgänger
üblicherweise ohne Helm in ihm unterwegs. Denn dieses Risiko
droht hauptsächlich bei starkem Sturm, bei dem man schon aus
Gründen des gesunden Menschenverstands größte Vorsicht beim
Waldbesuch walten lässt, oder auch einmal ganz darauf verzichtet
-- jedenfalls (falls man derlei unterlässt) Regreßansprüche an
den Waldbesitzer im Unfall-Fall völlig aussichtslos wären.
Neuerdings sind schon Urteile bekannt worden, die Waldbesitzer
dazu verpflichten, ihnen bekannte morsche Bäume an begangenen
Wegen zu fällen, da man von waldunkundigen Waldbesuchern
offenbar selbst die Beachtung simpelster Vorsicht nicht mehr
voraussetzen kann.
Nun scheint es so, als würde der Waldbesuch erstmals seit
Ausrottung von Räubern und gefährlichen Raubtieren wieder risikoreicher.
Oder was anderes besagt das Schild unten?
Kann man vom Waldbesucher verlangen, bei Frosttemperaturen auf
den Waldbesuch generell zu verzichten, weil Eiszapfen von den
Windmühlenflügeln wie Geschosse einschlagen können? -- und die
Anlagenbetreiber aus Kostengründen auf technisch mögliche
Flügelbeheizungen verzichten, die diesem Sicherheitsrisiko
abhelfen könnten? -- Um hier nur das wahrscheinlichste Unfallszenario
zu nennen. Es gibt auch vollends groteske (gleichwohl schon
vorgekommene) wie abbrechende Flügel, brennend in den Wald
herabstürzende Triebwerksgondeln, oder gleich als Ganzes
umfallende Windräder, mitsamt herausgebrochenen Fundaments! (was
dessen komplette "Beseitigung", siehe Märchen Nr. 4, immerhin
eventuell erleichtern könnte...)
 Quelle + Weiterführender
Link
Quelle + Weiterführender
Link
Man beachte den Abstand des Schilds von der Anlage.
100.000-Euro Frage: Was ist hier "ausreichend"? - Wenn Du zu
nah dran warst und getroffen wirst, dann war es wohl nicht
ausreichend. (Die Aufstellung von derartigen
Schildern, auch "Keine Haftung" etc., ist haftungsrechtlich
übrigens so gut wie unwirksam, und damit zum allergrößten Teil
überflüssig. Wer und in welchem Umfang haftet, regeln Gesetze
und Rechtsurteile, nicht irgendwelche Schilder)
Märchen 7:
Nur Schwarzstorch und Rotmilan sind geschützt, nicht der
Mensch..!
Dies ist nicht richtig. Abgesehen vom Mindestabstand von 1000m um
Siedlungen, und 500m um Einzel-Wohnhäuser, können auch Teile der
Landschaft und Kulturgüter vor der "Verspargelung" geschützt sein.
Die Erholungs- und Freizeitfunktion des Waldes sollen möglichst
wenig beeinträchtigt werden, "Überprägung des
Landschaftscharakter" vermieden werden (laut
Aufstellung zum Energie-Regionalplan des RP Gießen vom
6.11.2013, siehe Link). Windräder entlang historischer
Altstraßen und beliebter Hauptwanderwege oder nahe bei
Hügelgräbern sind nach diesen Anforderungen unzulässig.
Entsprechende Planungen laden zum Widerspruch geradezu ein.
Märchen 8:
"Bürgerbeteiligung" und "Transparenz"
Erste "Bürgerinformationsveranstaltung", Herbst
2012: Wenn Politiker wortreich verkünden, es sei noch längst
nichts beschlossen, es werde auch nichts
beschlossen gegen den Willen der Bürger -- dann wissen diese
Bürger im allgemeinen schon vorher, das das nur Lug und Trug ist. Man
macht eine Werbeveranstaltung, hält sich möglichst im unklaren
und allgemeinen, und erklärt dass, wegen der komplexen
Genehmigungsverfahren, erforderlicher Gutachten, der
"Bürgerbeteiligung" usw. vor 2014 auf keinen Fall gebaut wird.
Für die etwas Begriffstutzigen, fällt auf dem Podium, also den
Veranstaltern, sogar der Satz "Aber
wer das Gutachten bestellt, der bestimmt auch was drin
steht, so ist das ja immer". Ja, genau so
ist das ja immer, das kennen wir alle. Nach diesen Worten wird
auch dem letzten klar, dass das Ganze eine Farce ist, Einwände
und kritische Fragen sowieso nicht ernstgenommen (und als
"Polemik" abgetan) werden. Hier könnte man eigentlich
geschlossen aufstehen und gleich wieder gehen! In der nächsten
Ausgabe des Gemeindeblättchen steht dann, man habe die Absicht,
bzw. man müsse wohl auch in Weilrod Windräder aufstellen --
niemand wird den Sinn dieser unverbindlichen Aussage in Frage
stellen wollen! Und dann: wird es plötzlich still,
während es intern im (Wild-) Schweinsgalopp weiter weiter
geht: Vier Monate nach der Werbeveranstaltung liest der
überraschte Bürger in der FAZ (4.1.2013) dass die
Gemeindevertretung in aller Stille einen Vertrag mit der
Windrad-Betreibergesellschaft unterschrieben hat (dazwischen
wird man ja hoffentlich auch noch verhandelt haben). Wo
blieb da die Bürgerbeteilung? Und bauen will man nun "in jedem
Fall bereits 2013". Merke: Behördenmühlen mahlen
vor allem dann langsam, wenn es um Bürgerangelegenheiten geht!
"Der Bürger" wusste das natürlich schon vorher. Der Hesse
ist ein bisschen lethargisch, aber er legt Wert darauf, ein "Cleverle"
zu sein, und alles immer schon vorher zu wissen,
besonders bei uns auf dem Land. Im Ergebnis macht es allerdings
keinen Unterschied: Mit dieser Haltung ist er gut regierbar,
denn er verhält sich immer erwartungsgemäß der Mächtigen - Mag
man es selbsterfüllende Prophezeiung nennen oder erlernte
Hilflosigkeit; ich bin da nicht so sicher.
Politisch durchgepeitschte Großprojekte und Transparenz
sind Gegensätze die sich niemals vereinen lassen - das war schon
immer so, und wird vermutlich auch immer so bleiben!
Anmerkungen/ Fußnoten
*) Wenn ein Waldgebiet vom Wind angeströmt wird, sorgt ein in
diesem stehendes Windrad natürlich für Störungen in der
gleichmässigen Anströmung: Zum einen durch Verwirbelungen der
Rotorblätter, wichtiger wohl aber durch seinen bremsenden
Einfluß auf den Wind vor und hinter dem Windrad:
Das Windrad entzieht dem Wind Energie, um selbst welche zu
erzeugen, muss ihn also notwendigerweise bremsen. Man braucht kein
Aerodynamiker sein, um zu sehen, dass der sich vor und hinter dem
Kraftwerk stauende Wind, den umgebenden Wind (also den
"nicht gebremsten") um das Windrad herum umso mehr beschleunigt.
Dieser beschleunigte Wind versucht (ebenso wie bei einem
schnell fahrenden Auto) das Windrad zu allen Seiten zu umgehen.
Nach unten hin ist dieser Ausweichraum durch die Waldoberfläche
begrenzt. Der nach unten abgelenkte Wind wird hierdurch noch mehr
beschleunigt und schlägt nun in der für das Windrad geschlagenen
Schneise ein.
Windräder sollen ja meist in Nadelwald gestellt werden -
Nadelwald ist an seinen Schlaggrenzen aber auch ohne solche
"Windverstärker" schon ausgesprochen windbruchanfällig. Der Effekt
der Windbremse bzw. -beschleunigung ist auch für
aerodynamische Laien offensichtlich. Vermutlich wird der Effekt
umso stärker sein, je besser der momentane Auslastungsgrad der
Anlage, je optimaler die (automatisch gesteuerte) Anstellung der
Windflügel ist. Wird das Hinderniss für den Wind "zu groß", umgeht
der Wind das Windrad zu stark, unmittelbar sinkt dessen
Energieerzeung, und die Steuerelektronik wird die Anstellung der
Flügel oder den Widerstand des Motors/ Getriebes korrigieren. Der
Effekt hat also direkt mit der profitabelsten Betriebseinstellung
des Windrads zu tun. Umso erstaunlicher ist, dass es noch keine
Untersuchungen zu geben scheint, die den Einfluss eines Windrads
bei Starkwind auf den Wald beschreiben.
**) Vollaststunden ist eine wichtige Kenngröße im
Kraftwerks- oder Anlagenbau, um den Auslastungsgrad einer
Anlage zu bestimmen.
Sie gibt an, wieviele Stunden im Jahr ein Kraftwerk (theoretisch)
mit seiner angegebenen vollen Nennleistung laufen müsste, um einen
tatsächlich geleisteten, oder prognostizierten Ertragswert (KWh im
Jahr) zu liefern. Warum rechnet man so? Windräder laufen mal
schnell, mal langsam, manchmal auch gar nicht. Windräder haben
also bauartbedingt eine geringere mögliche Vollaststundenzahl als
Verbrennungskraftwerke, denen der nötige Kraftstoff jederzeit
zugeführt werden kann, die aber aus anderen Gründen oft
abgeschaltet werden. Der Auslastungsgrad eines Kraftwerks lässt
sich nur über eine längere Zeitperiode bestimmen, hierfür nimmt
man das Jahr (was im Fall von Windkraftwerken auch etwas ungenau
ist, denn es gibt Jahre mit viel und solche mit wenig Wind). Die
Angabe der Vollaststundenzahl tut so, als hätte es seine
Jahresleistung nur unter "Vollast" (mit seiner Nennleistung)
erbracht und die ganze übrige Zeit still gestanden. Aus dieser
Kenngröße bzw. ihrer Division durch die Gesamtstundenzahl im Jahr
(grob 8.760 Std.) ergibt sich der Auslastungsgrad der
Anlage.
Auf "windhöffigen" Standorten erreicht eine Anlage unter sonst
gleichen Bedingungen eine höhere Vollaststundenzahl als auf
windschwachen. Je schlechter der Wind in einem Jahr, desto
geringer die Vollaststundenzahl. Je öfter das Kraftwerk
stillsteht, sei es servicebedigt oder aufgrund notwendiger
Abschaltung (Vogelzug o.ä.) - es sei denn bei völliger Flaute -
desto geringer die Vollaststundenzahl. Ein großes Windrad auf
einem Standort mit bloß mittlerer Windhöffigkeit ist nicht
notwendigerweise besser ausgelastet, als ein kleineres. Für jede
Anlage mit einem gegebenen Erstellungsaufwand, einem gegebenen
Finanzierungskonzept lässt sich eine Vollaststundenzahl errechnen,
über dem die Anlage für den Betreiber rentabel ist. Darunter ist
sie unrentabal. In jedem seriösen Anlegerprospekt
("Bürgerwindpark") sollte diese Zahl (Gewinnschwelle) angegeben
sein, damit sich der Anleger ein genaues Bild machen kann.
***) ein Anlagenbetreiber brachte das auf den Punkt mit dem Satz
"wenn die Bedingungen stimmen, lohnen sich Windkraftanlagen auch
an Standorten wo fast kein Wind weht". Als groben Richtwert gibt
DEWI jedoch 2000 Vollaststunden als Minimum für die
Rentabilität einer Anlage an. Davon ist man in der Realität oft
weit entfernt. Aufgrund des in der hiesigen Region stark erhöhten
Kostenaufwands für Baustellen und Zuwege, der allgemein schlechten
Verkehrszugänglichkeit dürfte dieser Schwellenwert, ab dem ein
Betrieb der Anlage gewinnbringend ist, hier noch höher liegen
****) Geplante Abholzungsfläche in Neu-Anspach (Feb. 2014):
69.000qm für 5 Anlagen (also zweieinhalb mal soviel, wie von der
Projektentwicklungsfirma und der Stadt gegenüber den Bürgern
angegeben)
Links:
Nachricht:
Dombach gründet Bürgerinitiative gegen Windpark Weilrod
Bewegung:
Gegenwind in Waldsolms-Cleeberg
Bewegung:
Rettet den Taunuskamm
Bewegung:
Keine Windräder am Galgenberg bei Villmar/Weyer (Danke für die
klaren Worte!)
Infos
der im Dez. 2013 gegründeten Bürgerinitiative Rennstraße
(mit Visualisierungen der geplanten WEA's)
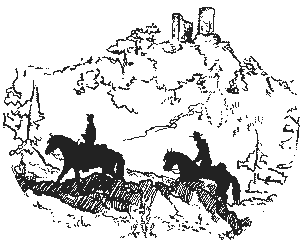
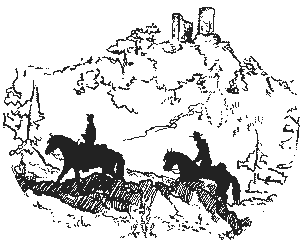



 Quelle + Weiterführender
Link
Quelle + Weiterführender
Link