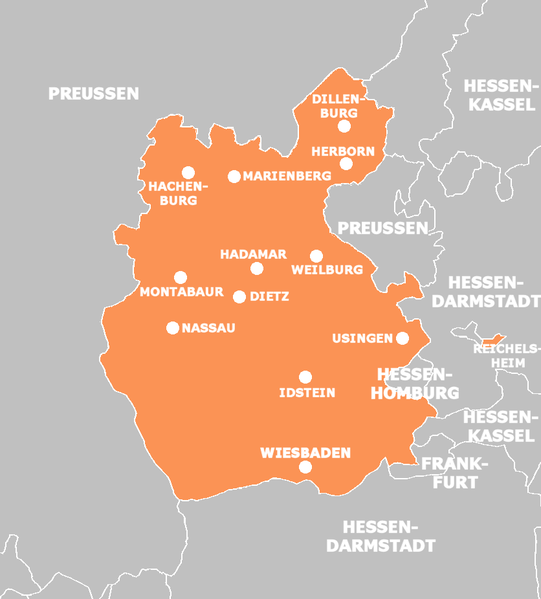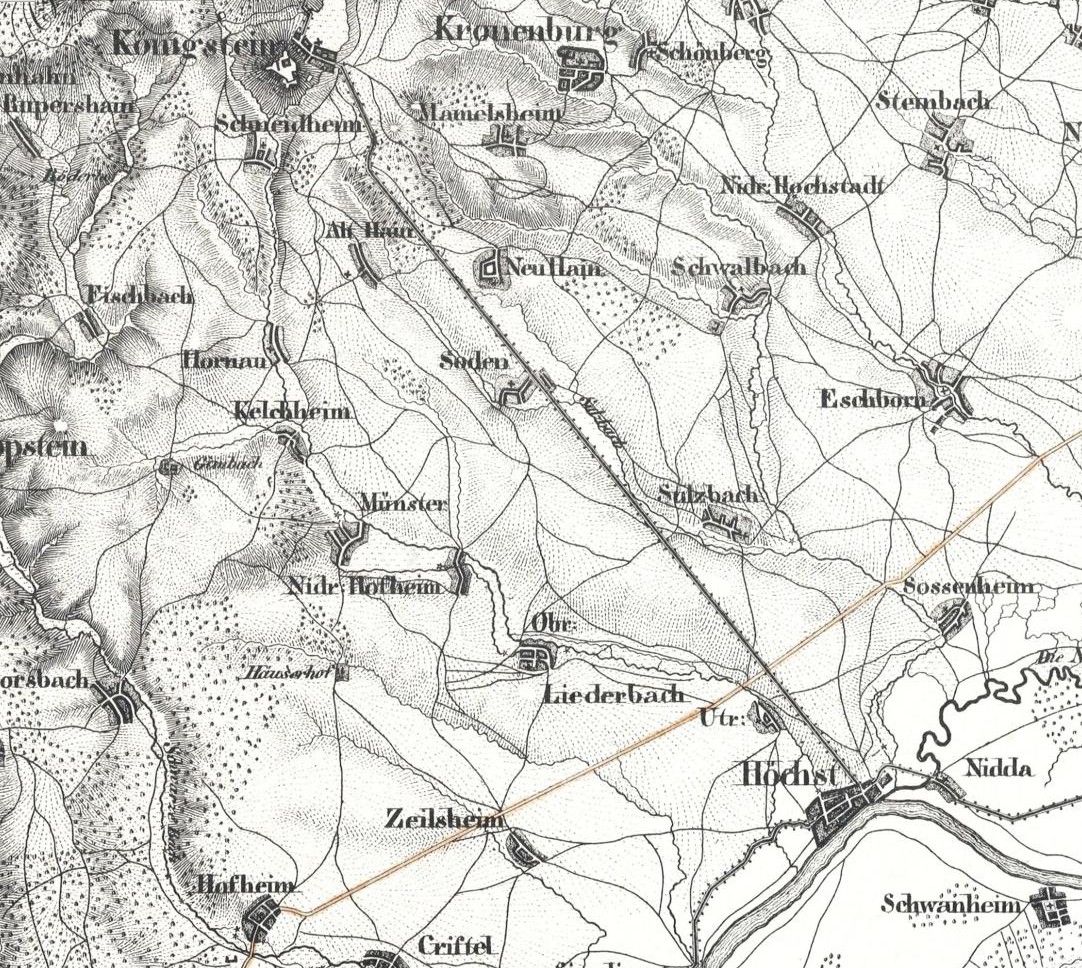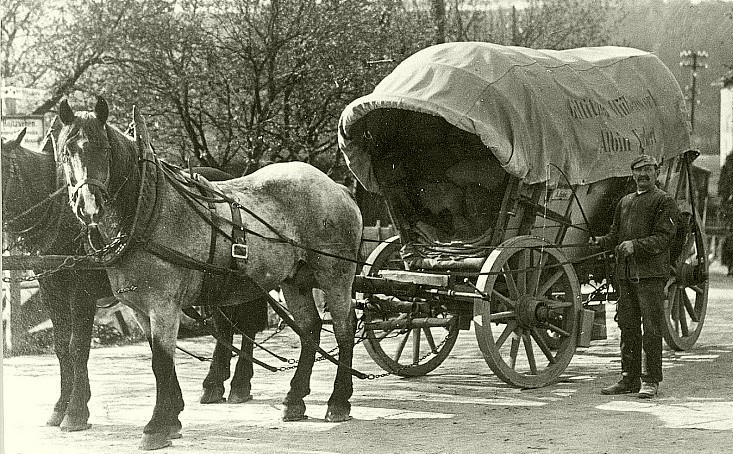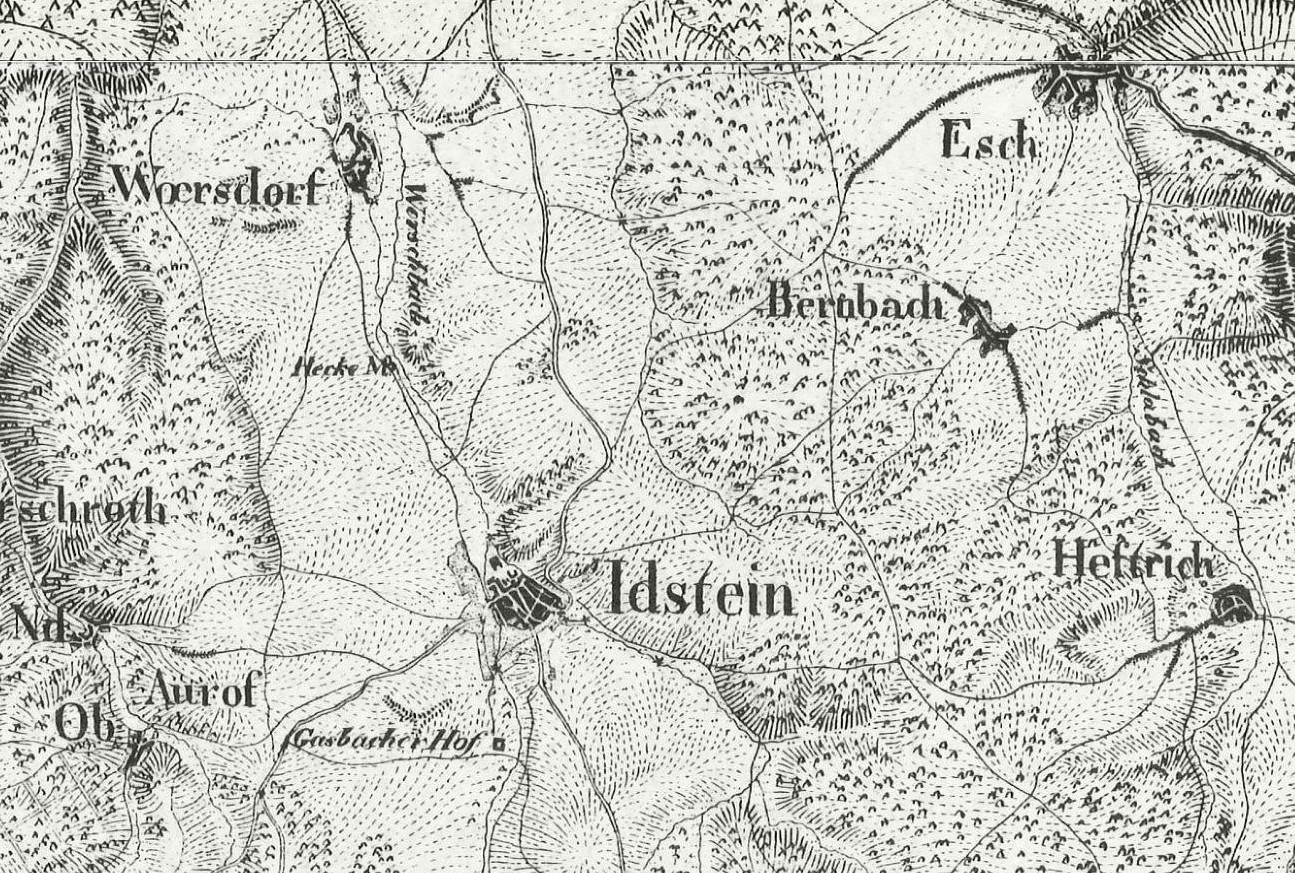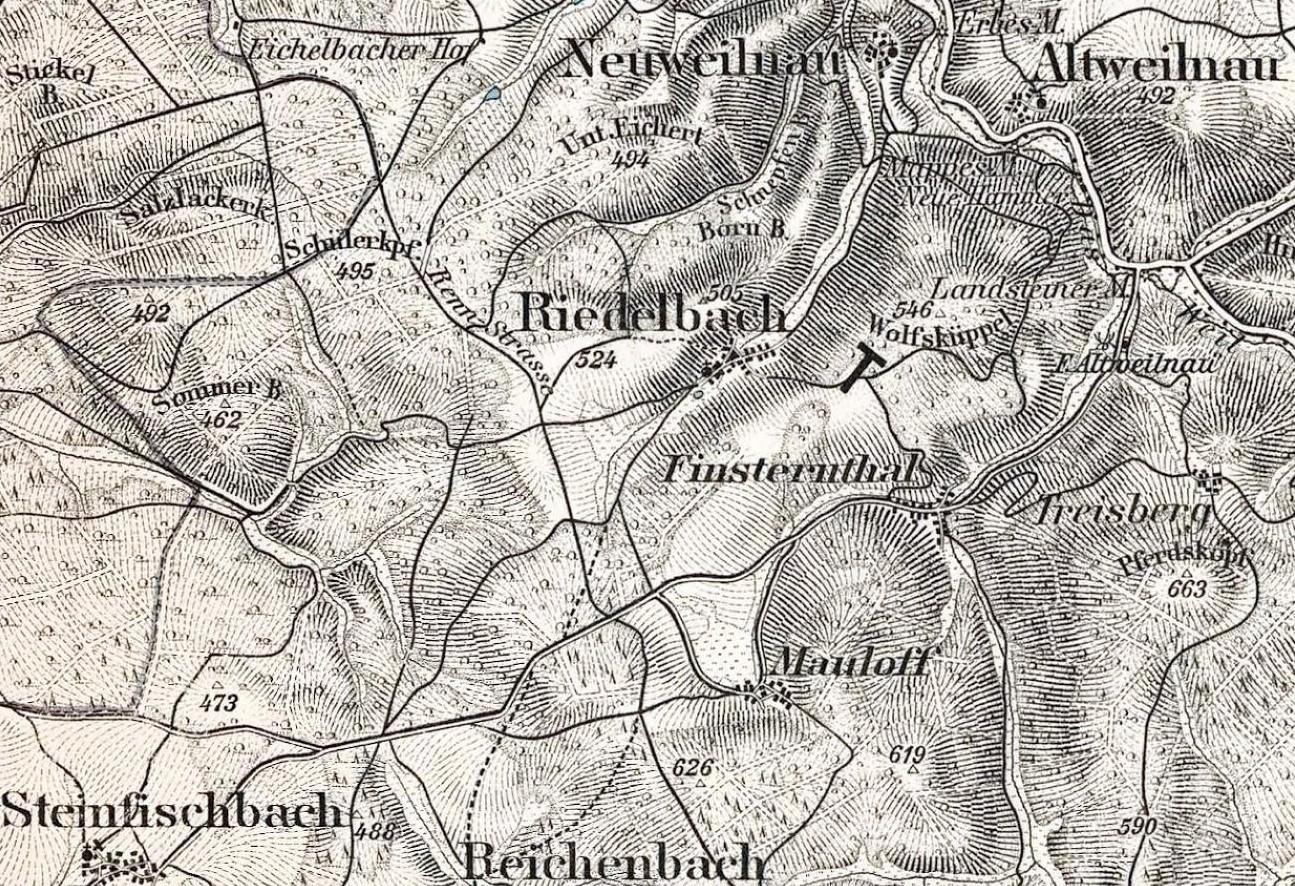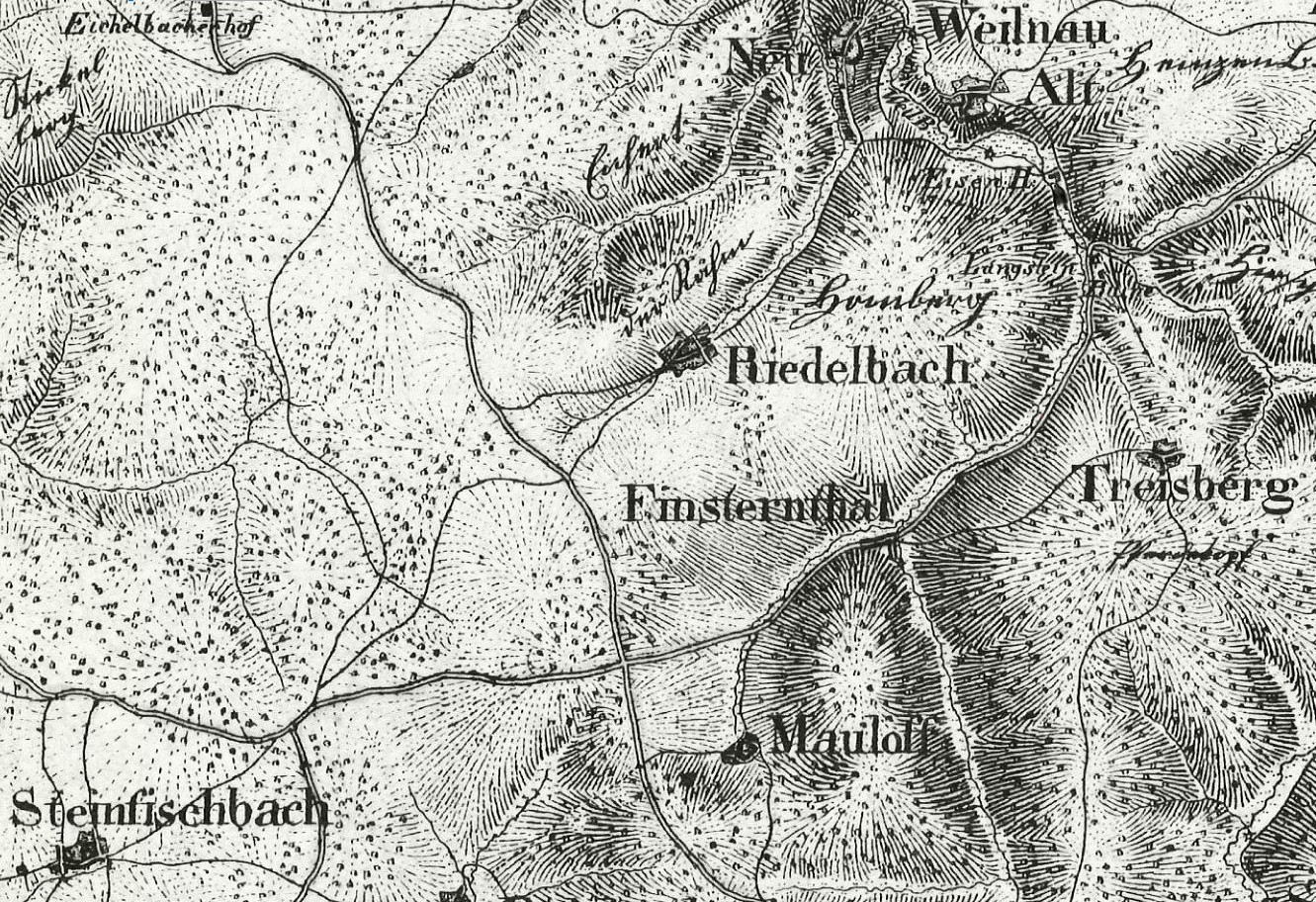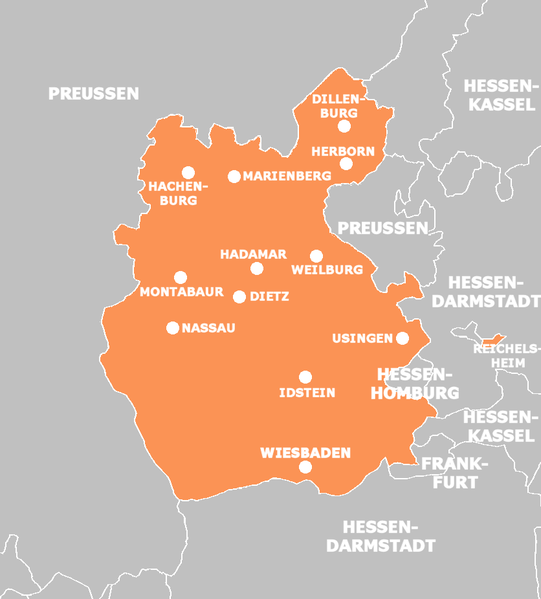 |
Zu Beginn des 19. Jahnhunderts
verlief der Vekehr größtenteils noch immer über die seit dem
Mittelalter oder der Frühzeit bestehenden, niemals genau
erfassten, geschweige denn in Karten gezeichnete oder
beschilderte, manchmal von Bauern oder der Obrigkeit
willkürlich verrammelten, oft nur bei Einheimischen
bekannten unbefestigten natürlichen Landwege und
Ortsverbindungswege - trotz der zu dieser Zeit stark
ansteigenden Bevölkerung, Gewerbe, Bergbau und lokaler
Kleinindustrie wie Töpfer- und Schmiedewaren.
Hessen war zu dieser Zeit in mehrere, wirtschaftlich und
verkehrstechnisch ungünstig geschnittene und auf Dauer nicht
lebensfähige Kleinstaaten zersplittert. Die Fürsten hatten
nur soweit Interesse am Straßenbau, als dies zu miltärischen
oder Postzwecken diente, trotz vollmundiger Bekundungen auch
den "Commertz" fördern zu wollen.
Hinweise über die vorhandenen "gebauten Straßen" (Chausseen)
in unserem Gebiet liefert am zuverlässigsten die Preußische
Generalstabskarte 1:86.400 (PGK), sowie die Karten
der Tranchot-Müffling'schen Landesaufnahme.
Die Karte links zeigt das Herzogtum Nassau. Bei
seiner Gründung 1806 hatte das Gebiet rd. 303.000 Einwohner.
Obwohl die größten "Städte" darin sehr klein waren - Wiesbaden
(5.000) und Limburg (2.600) - war das
spätere Kernland Hessens mit rd. 62 Einwohner/qm. mäßig,
nicht dünn besiedelt. Der ganz überwiegende Teil der
Nassauischen Bevölkerung lebte also in Dörfern, was aber
nicht bedeutete, dass er auch als landbesitzender Bauer ein
Auskommen hatte. Aus der Not heraus waren die meisten
Kleinbauern und Kleinhandwerker oder Tagelöhner zugleich.
Als Zugtiere in der Landwirtschaft verwendete man die
Milchkühe, von denen man in der Regel nicht mehr als zwei
besaß. Ochsen für die Feldarbeit zu haben kündete von
Wohlstand, der Besitz von Pferden von Reichtum. |