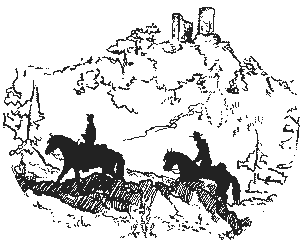
(c) Frank Mechelhoff 2019 - Kopien speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig
Siehe Copyright-und Kontakt-Hinweise
Neu April 2019 - Update Mai 2024
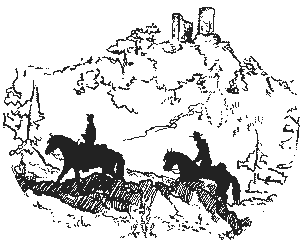 |
TAUNUSREITER (c) Frank Mechelhoff 2019 - Kopien speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig Siehe Copyright-und Kontakt-Hinweise Neu April 2019 - Update Mai 2024 |

| Extreme | Vereinigung der Gegensätze |
| tollkühn ↔ feige | mutig und doch vorsichtig |
| hochmütig ↔ unterwürfig | selbstbewußt und doch bescheiden |
| verschwenderisch ↔ geizig | sparsam und doch freigiebig |
| Bereiche | Beispiele | |
| ⇑ | Vernunft | Selbstkritik, Selbstbeherrschung |
| ⇑ |
Ethik | Gewissen, Mitleid, Moral |
| ⇑ | Ichbewußtsein | Reflektierendes Denken, Nachdenken |
| ⇑ | Sprache | Begriffe, Abstraktion, Symbolik, Ausdrucksweisen, Wortbildung |
| ⇑ | Wille | energisch, schwach |
| ⇑ | Charakter | freundlich, mutig, feige |
| ⇑ | Verstand | kombinieren, schlußfolgern |
| ⇑ | Gedächtnis | Orts-, Personen-, Zahlengedächtnis |
| ⇑ | Gefühl | Lust-, Schmerzgefühl |
| ⇑ | Bewußtsein | Averbales, assoziierendes Wissen |
| ⇑ | Empfindungen | Sehen, Hören,
Temperaturempfinden |
| ⇑ | Reflexe | Lidreflex, Speichelreflex |
| ⇑ | Instinkte | Orientierungsinstinkt, Zeitsinn, Nahrungsinstinkt |
| ⇑ | Triebe | Sozialtrieb, Bewegungstrieb, Ernährungstrieb |
| ⇑ | Vitale Impulse | Vegetative Kreisläufe, Zellteilung, genetische Information |

 |
Der große Schriftsteller Leo Tolstoi
ritt bis ins hohe Alter - hier 81 Jahre - freizeitmäßig. Eines seiner in dieser Hinsicht beeindruckendsten Werke ist die Erzählung "Herr und Knecht" (1895) |

Nachtrag (2023) : Altruistisches Verhalten und Empathie bei TierenIn den letzten zwei Jahrzehnten haben insbesondere die Forschungsarbeiten von Frans de Waal (1948-2024) zu Ethik im Tierverhalten bei Menschenaffen für eine Wiederbelebung des Interesses an Tierpsychologie gesorgt. Blendinger stellt Ethik und Moral an die zweithöchste Stelle seiner psychischen Stufenleiter, sie ist für ihn spezifisch menschlich. Frans de Waal hat entdeckt, dass altruistisches und empathisches Verhalten auch bei hochentwickelten Tieren vorkommt, und hält die "Moral" nicht für eine Erfindung des Menschen, oder genauer: menschlicher Religionen. Sie war in Ansätzen schon vor dem Menschen da. Auch ein Gefühl für Gerechtigkeit/"Wie Du mir, so ich Dir" scheint zu existieren. Eine Abgrenzung zu vorhandenen (Mutter-/ Gruppen-) Instinkten ist dabei schwierig und gelingt oft nicht ganz sauber. Jedoch scheint sicher, dass auch Ethik und Moral nicht bloß in reflektierter Weise und "höchster Ausprägung" dem (erwachsenen) Menschen eigen ist, sondern in Form einer "Prä-Moral" auch bei Kindern vorhanden, und bei höheren Tierarten zumindest in beobachtet worden ist. |