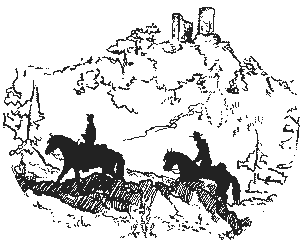 |
TAUNUSREITER
(c) Frank Mechelhoff 2005-2012 -
Kopien speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig
Verwendung der Bilder in eigenen Websites
oder zu geschäftlichen Zwecken ohne meine
schriftliche Genehmigung nicht gestattet
Kontakt: taunusreiter
 yahoo.de yahoo.de
Update Juni 2017 |
WANDERREITEN
- die andere Krone der Reiterei
Frank Mechelhoff -Wanderrittführer
VFD

Teil 2: SICHERER PFERDETRANSPORT
Gewöhnung an Hänger und Verladen
Auch wenn ich als angehender Wanderreiter (noch) keinen Pferdehänger
besitze, ist es nur sinnvoll und nützlich, wenn mein
Pferd ohne Widerstand oder Aufregung auf einen Hänger geht, wenn es
denn sein muss - es kann, z.B. bei einer Tierarztbehandlung, sogar
sein Leben davon abhängen. Es ist also sinnvoll das zu üben, soweit
sich Gelegenheit dazu bietet. Nur leider sind die meisten
Pferdebesitzer - häufig aus gutem Grund - wenig geneigt, ihre Hänger
zu solchen Übungszwecken auszuleihen. Ein eingeschlagenes Rücklicht
gehört noch zu den Kleinigkeiten, die dabei passieren können, und
sehr oft erweist sich der Hänger noch als das stabilere von beiden.
Also Vorsicht!
Merkwürdigerweise nehmen viele Pferde die Attitude ihrer hängerlosen
Besitzer an, wonach diese Gefährte "eigentlich unnötig" seien und
weigern sich standhaft sie zu betreten. Eine meiner Stuten stand vor
jeder Verladung eine Minute still um über das Thema nachzudenken,
und guckte mich dabei oft mitleiderregend an, als würde sie fragen
"Können wir das nicht lieber laufen?". Gewiss können wir, jedenfalls
oft. Strecken unter 30km transportiere ich aus alter Gewohnheit nur
in Ausnahmefällen.
Das Üben und natürlich auch das "wirkliche" Verladen sollte in
größter Ruhe und Entspannung geschehen. Wenn ich ein Pferd verlade
versuche ich meinem Pferd gegenüber so zu wirken, als hätte ich bis
auf das Verladen keine weiteren Pläne mehr für den Tag - und es sei
völlig sicher, dass es innerhalb der nächsten 5 Minuten im Hänger
ist. Die Wirkung einer solchen Haltung auf ein Pferd ist gar nicht
gering zu schätzen. Jemand mit gegenteiligem Ausdruck und
Körperhaltung ("das wird heute sowieso nichts...") wird sein Pferd
tatsächlich nicht in den Hänger bekommen. Ich bin auch kein Freund
vieler Hilfsmittel. "Weniger ist oft mehr" gilt auch beim Verladen.
Ich benötige deshalb nur ein wirklich stabiles und einwandfreies
Halfter, einen guten 5 Meter langen Führstrick aus einem Material
das nicht in die Hand schneidet, oder beim schnellen Durchgleiten
brennt (am besten ein gedrehtes Hanfseil von 16-20mm Stärke). Für
manche Pferde halte ich ein Seil von 15 Metern, sowie einen
spanischen Kappzaum (es geht auch eine Trense) in Reserve. Keine
Longe, keine Besen. Und weder Zuschauer noch Helfer. Dafür
Futtereimer und einen unerschöpflichen Vorrat an Brot oder
Mohrrüben. Und ebensovel Geduld.
Ich respektiere,
dass mein Pferd den Hänger als Zumutung
und widerwärtige
Einschränkung seines wichtigsten Gutes, seiner Bewegungsfreiheit, ansieht.
Während der Fahrt werde ich vorne im Auto auf bequemen Polstern
sitzen, habe vor mir die schöne weite Straße - mit Glück staufrei,
Radio oder ausgesuchte Musik, kühle Luft... Es ist leise, vielleicht
habe ich sogar einen kühlen Drink neben mir. Nichts davon hat während der
Fahrt das Pferd, und es würde vermutlich auch auf andere Dinge wert
legen: eine weite Wiese mit Gras und reichlich Platz allem
unangenehmen auszuweichen, seine behuften Kameraden, ein nett
plätschernder Bach, ein schattiger Baum usw. Selbstredend muss ich
ihm die Fahrt so wenig unangenehm wie möglich machen, den Hänger mit
dem besten Pferdekomfort wählen den ich mir leisten kann usw.
Damit ist es aber nicht genug: Ich muss es bitten und überzeugen, diese
Freiheit (auf die es ein Recht hat) mir zuliebe für eine Weile
aufzugeben. Haben wir ein gutes
Verhältnis zueinander, werde ich es schaffen dass es nicht nur
seine Furcht gegen den Hänger verliert - das dauert in der Regel
nicht so lange - sondern auch seine Vorbehalte gegen das
Eingesperrt- und Ausgeliefertsein - und das ist meistens der
Hauptgrund nicht in den Hänger zu gehen (was manche ja auch richtig
erkennen: "der hat eigentlich gar
keine Angst!").
Ich lege keinen Wert
darauf dass meine Pferde in den Hänger (oder sonst irgendwohin)
gehen ohne nachzudenken oder zu stocken. Sie brauchen mir keinen Kadavergehorsam zeigen.
Sie sollen sich mit dem Gedanken beschäftigen können - und bei
Lebewesen die gedanklich nicht so flexibel sind wie manche (auch
nicht alle!) Zweibeiner, die gern auf Gewohntem beharren, braucht
das seine Zeit. Das lange Seil benötige ich nur bei Pferden die ihre
Kraft einsetzen um sich unerlaubt weit vom Hänger zu entfernen, um
sich dem Nachdenken über den Transport zu entziehen. Ich wende es
immer nur 1x an, nie gleichzeitig mit dem Kappzaum, und nur in
sicherer Umgebung.
Helfer kann man meist deswegen nicht wirklich brauchen, weil sie das
Pferd ablenken, und auf Ideen kommen irgendetwas "tun" zu müssen,
wie etwa mit einem Stöckchen von hinten nachzuhelfen dass das Pferd
auf den Hänger geht, was bei schwierigen
Pferden fast immer den gegenteiligen Effekt hat, bei gutmütigen und willigen aber
eine zumindest überflüssige Einschüchterung ist. Wenn ich selber
gebeten werde beim Verladen zu helfen, lasse ich mir deshalb
genaueste Anweisungen geben, was ich wann tun soll. Ausnahmen
hiervon sind Helfer die das Pferd besser kennen als der Verlader.
Sicherer Pferdetransport über längere Strecken
Beim Thema "Verladen" ist meines Erachtens auch ein Gedanke über Fahrtzeiten angebracht. Ich bin
kein Berufskraftfahrer, fahre auch Pferde nicht übermäßig oft, was
zur Folge hat, dass mich langsames vorausschauendes Fahren über
mehrere Stunden ausgeprägt ermüdet, weshalb ich beim Fahren mit
Hänger öfter Pausen machen muss als ohne, obwohl ich langsamer
vorankomme als ohne. Den meisten Pferdebesitzern dürfte es kaum
anders gehen. An jeder Tankstelle und an jedem Stop biete ich meinen
Pferden deswegen Tränkwasser an. Ich habe immer einen gefüllten
Wasserkanister dabei wenn ich Pferde transportiere - noch aus der
lange zurückliegenden Zeit als mein Zugfahrzeug noch etwas
schwächlich war und ich dem Motorkühler nicht recht vertrauen
konnte... Das genügt aber nicht, weil die meisten Pferde
im Hänger ihren Harn verhalten und deswegen nicht saufen wollen. Ich bin mir des
Verladens meiner Pferde derart sicher, dass ich sie auch auf längeren Pausen, etwa ab
drei oder vier Stunden Fahrt, auslade
und fressen und urinieren lasse. Selbst dann wenn
ich zwei von ihnen allein ohne Helfer fahre. Das Ausladen und
fressen lassen ist auch auf vielen Autobahnparkplätzen möglich, die
etwas mehr Fläche haben und von der Fahrbahn etwas abgesetzt liegen.
Das kann man sogar mit einem kleinen Picknick verbinden, setzt aber
absolut anbinde- und verladesichere sowie führige Pferde
voraus(!), und soll niemanden zur Nachahmung nahe belebten Straßen
veranlassen, der sich darin unsicher ist, sondern nur zeigen was
Ziel der Ausbildung ist. Ich halte es jedoch vom Standpunkt
der Pferdegesundheit noch für viel
weniger nachahmenswert, Pferde ohne auszuladen 8-12 Stunden
im Hänger stehen zu lassen, wie dies häufig genau mit den weniger
verladesicheren Pferden gemacht wird, die man "froh ist endlich im Hänger zu haben"..
Das Pferd ist ein Bewegungs-, kein Standtier. In der Box kann
es wenigstens noch ein paar Schritte gehen. Ich weiß auch, dass
viele ihre Strecken nach der Devise aufteilen "möglichst viel an einem Stück"
-- aber dann müssen sich ihre Pferde auch länger von der Fahrt
erholen und dürfen nicht sofort zu Leistungen herangezogen werden.
Meine Pferde aber steigen, auf meine Art transportiert, am Zielort
so entspannt aus, dass sie nach einer "Akkomodierung" von 1/2 Stunde
am neuen Ort (grasen lassen am langen Strick) geritten werden
können.
Solche Erziehung kann auch im Falle von Pannen und anderen
Fällen nützlich sein: Mir ist schon ein Reifenplatzer auf einer
gutbefahrenen, älteren Bundesstraße passiert, wo ich keinen sicheren
Stand hatte, und ausladen musste um den Reifen sicher zu wechseln.
Bevor ich riskiere, dass mein Hänger aufgrund einer Pferdebewegung
im Inneren vom Wagenheber fällt, dabei beschädigt wird oder mich
schwer verletzt, werde ich doch lieber mein Pferd ausladen, es in
der Nähe anbinden, wo es vielleicht noch "Pause" machen, Baumzweige
o.ä. fressen kann, und dann die Arbeit schnell und sicher zuende
bringen.
Der Pferdehänger
Man kann auch immer von
zuhause aus losreiten, dann braucht man überhaupt
keinen Hänger und auch kein Zugfahrzeug. Das ist nicht das
schlechteste! Schülern oder Studenten bleibt meist ohnhein nichts
anderes übrig. Wenn man aber in seiner Umgebung alles abgeritten
hat, kommt mit den Jahren der Wunsch nach einem eigenen Hänger
auf, um lange Anmarschwege durch möglicherweise schon lange
bekannte oder unattraktive Gegenden abzukürzen. Es muß gesagt
werden, dass mit Benutzung von Hänger und Zugfahrzeug man meist
einen erheblichen Teil an Flexibilität und Spontanität einbüßt,
was schon oft dazu geführt hat, dass Reiter, seitdem sie so viel
Equipment haben, gar nicht mehr zum Reiten kommen, weil die
Umstände um einmal in die Gänge zu kommen viel zu groß werden!
Denn oft kommen noch eine Reihe von Anschaffungen dazu,
vordergründig, um das Hobby zu erleichtern (der Markt bietet ja
soviel an!) - aber in Wahrheit wird es erschwert, weil vielzuviel
Zeug zusammengekommen ist, was die Vorbereitung eines Wanderritts
kompliziert und in die Länge zieht. Hier gilt der Satz, dass
weniger mehr sein kann, und die Kunst der Selbstbeschränkung.
Es ist also an dieser Stelle überflüssig sich lang und breit über
moderne Ausstattungsdetails des idealen
Wanderritt-Pferdetransporters auszulassen, nur soviel:
- Statt eines neuen minderwertigen Billighängers schaue man,
wenn das Geld knapp ist, nach guten gebrauchten Markengeräten.
Hänger werden meist sehr wenig bewegt und halten an sich sehr
viel länger als Autos. Zudem sind sie mit handwerklichem
Geschick gut instandzusetzen. Es gibt über 30 Jahre alte Hänger
die mit sorgfältiger Pflege und Wartung, und dem 2. oder 3.
Boden, immer noch sicher ihren Dienst tun. Den Pferden ist dies
egal
- Schwere und stabile Hänger sind sicherer. Lieber das
Geld investieren und ein ordentliches Zugfahrzeug kaufen.
Einachshänger sollten nicht mehr gekauft werden (zu unsicher).
Ein- oder 1,5-Pferdehänger sind deutlich weniger flexibel im
Einsatz, nur unwesentlich leichter von Gewicht, und gar nicht
leichtzügiger. Überbreite (oder überhohe)
Zweipferdehänger sind jedoch auch unnötig (schwer und
unhandlich). Die älteren Hängerinnenbreiten von 1,55-1,65 sind
für unsere meist kleineren Wanderreitpferde voll ausreichend
- Hänger mit den "altmodischen" Rohrdeichseln ziehen sich, wenn
sie auch sonst in Schuss sind, exakt so wie die mit neueren mit
V-Deichseln - egal was Hersteller oder Händler sagen, die gern
neue Hänger verkaufen wollen. Ich habe schon an Hängern
angebundene Pferde in V-Deichseln hineintreten sehen. Das sollte man
ausschliessen, indem ein Blech, Transportkiste o.ä. darauf
verschraubt wird. Auch ansonsten muss ein Hänger an dem Pferde
angebunden werden sollen, außen
möglichst glattflächig sein (was auch
Aerodynamik/Kraftstoffverbrauch sowie Reinigungsfähigkeit
verbessert). An Leichtbauhängern sollte man auch anbindesichere
Pferde nie anbinden; an normalen Hängern nur, wenn sie am
Zugfahrzeug angekuppelt sind.
- Polyhauben sind für die meist längeren Strecken die
Wanderpferde bewegt werden unbedingt empfehlenswert. Die
Marschtempi auf der Autobahn liegen ja doch näher bei 100km/h
als bei 80, und bei höherem Tempo oder in dichtem Verkehr, der
ja am Wochenende Standard ist, sind Planenanhänger unerträglich
laut und ein vermeidbarer Streß für die transportierten Pferde.
Vollpolyhänger sind gleich langlebig und entgegen gängigen
Glaubens reparaturfreundlicher als Holzhänger
- Die Frage der Aufstellung ist viel diskutiert worden.
Ich kann bloß für meine Pferde
sprechen. Diese schätzen keine Trennwände egal aus welchem
Material sondern haben gern soviel Platz wie möglich und stellen
sich auch gern leicht schräg hin, sogar wenn sie zu zweit
fahren. Ich habe ihnen daher vom Dorfschmied eine neue,
durchgehende Hinterstange aus Siederrohr anfertigen lassen (mit
Polsterung ca. 12cm dick) um ohne Trennwand fahren zu können.
- Die Innenausstattung soll hell und freundlich sein
(Innenbeleuchtung), variabel, verletzungshemmend und an allen
Kanten abgerundet. Auf Trennwände kann häufig verzichtet werden.
Verletzungsträchtige Holztrennwände sollte man rauswerfen, und,
falls man lieber mit Trennwand fährt, gegen Gummiwände ersetzen.
- Es ist unbedingt wichtig dass Vorder- und Hinterstangen nicht
bloß dick gepolstert (ca. 12 cm) und stabil sind,
sondern auch die richtige Höhe
fürs Pferd haben. D.h. es muß sich mit der Muskulatur der
Oberschenkel auf diese stützen können, wenn es sich auf diese
Art während der Fahrt ausbalancieren will. Hierfür muß die
Hinterstange eine Handbreit niedriger sein als der
Sitzbeinhöcker des kleinsten zu transportierenden Pferdes, so
daß es seinen Schweif bequem über diese legen kann. Unter gar
keinen Umständen dürfen die Stangen so hoch sein, dass es
sich das Kreuz anstossen kann! Hänger werden heute oft für
Pferde mit Riesen-Stockmaßen gebaut,
Freizeitpferde-Besitzer gucken in die Röhre! Oft reicht auch der
Verstellbereich hierfür nicht aus. Dann muß umgebaut werden. Der
Zollstock darf nicht vergessen werden beim Hängerkauf!
- Eine Sattelkammer/ Stauraum im Hänger ist durchaus
keine unnütze Spielerei. Auch wenn das Zugfahrzeug noch so groß
ist, kann es nur angenehm sein, zusätzlichen Stauraum für
sperrige Gegenstände wie Wasserkanister, Futtersäcke, Grillkohle
etc. zu haben. Es ist auch praktisch, wenn zum Übernachten im
Hänger ein Feldbett in die Seitenwand eingehängt werden kann.

Das Zug- und Troßfahrzeug
Hier gilt der lapidare Satz, dass das größte und
hubraumstärkste Zugfahrzeug, das man sich leisten kann, am besten
ist. Raum kann man kaum
genug haben: Meist wird das Fahrzeug ja auch zum Versorgen der
Pferde, Heranschaffen von Futter und ähnliche Aufgaben benötigt.
Pickups, Geländewagen, Kleintransporter und -busse sind zurecht
beliebt. Unter 100 PS Leistung wird das Ziehen mühselig, und 2l
Hubraum beim Diesel, 1.6l beim Benziner sind das absolute Minimum.
Darunter sind meist die Kupplungen unterdimensioniert und versagen
schnell den Dienst. Dieselfahrzeuge galten früher als
langlebig, was jedoch heutzutage wo aus 2l Hubraum selbst beim
Diesel 120 und mehr PS herausgeholt werden, nicht mehr zutrifft.
Zwar ist der Verbrauch dieser neuartigen Motoren unerhört sparsam
(zumindest ohne Hänger) jedoch kosten sie mehr Steuern,
Versicherung, und in den Großstädten droht das
Feinstaub-Fahrverbot.
Benziner benötigen wegen ihres schlechteren Drehmoments
mehr Leistung, um mit gleich starken Dieseln mitzuhalten. Schwache
und hochgezüchtete Dieselmotoren neigen oft zu Erhitzung und
thermischen Problemen wenn Hänger gezogen werden, und müssen mit
Feingefühl bewegt werden. Benziner haben diese Probleme eher
selten, fangen dafür im Hängebetrieb meist ungezügelt an zu
saufen. Heutzutage die wirtschaftlichste und langlebigste Lösung
dürften großvolumige, auf Gasbetrieb umgerüstete Benzinmotoren
sein. Nachteil: der Platzbedarf der Gastanks.
Klassische Wohnmobile sind als Zugfahrzeug ungeeignet. Meist sind
sie zu schwach motorisiert, das Heck ist nicht auf die Belastung
beim Ziehen konstruiert und der lange hintere Überhang (Abstand
Hinterrad-Anhängerkupplung) und das Übergewicht auf der
Hinterachse bringt Unruhe und Unsicherheit ins Fahrwerk. Zudem
fährt man sich leicht fest. Universell und am sichersten als Zug-
und Troßfahrzeuge sind schwere Geländewagen, die hier ihre
eigentliche Existenzberechtigung haben. Zu großer Luxus ist
natürlich eher reisehemmend, denn diese Fahrzeuge stellt man kaum
gerne 4 Tage auf einem abgelegenen Waldparkplatz ab, um einen
Wanderritt durch die Umgebung zu machen. Es gilt also, wie
überall, der Grundsatz einer gewissen vernünftigen
Selbstbeschränkung.
Es wäre gut, wenn die von Kleintransportern abgeleiteten,
praktischen Vans brauchbar wären, von denen es ein paar auch mit
Allrad gibt. Aber leider haben diese nie ausreichend hohe
Zuglasten, und zu kleine Motoren. Vielleicht hat ja einer der
Hersteller mal ein Einsehen. Bis dahin sind wahrscheinlich die SUV
(Sport Utility Vehicle) der beste Kompromiß zwischen
Zugfahrzeugeignung, Betriebs- und Fahrzeugkosten sowie
Alltagstauglichkeit und Fahrkomfort.
- weiter
mit Teil 3 (Wanderritte) -
- zurück zur
Homepage -
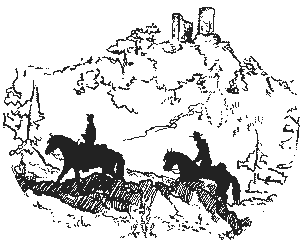
 yahoo.de
yahoo.de
