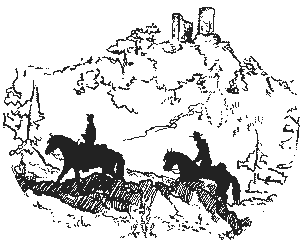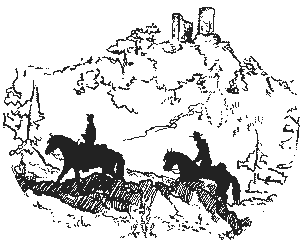 |
TAUNUSREITER
(c) Frank Mechelhoff 2005 - Kopien
speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig
Verwendung der Bilder in eigenen Websites
oder zu geschäftlichen Zwecken ohne meine
schriftliche Genehmigung nicht gestattet
Kontakt: taunusreiter  yahoo.de
yahoo.de
Neu auf der Seite 7.
Juli 2006
(Aktualisiert 2022)
|

Warum
nicht mal einen Distanzritt veranstalten ?
Es muß nicht immer Dressur und Springen
sein...
Sie wollen einmal ein "ganz anderes"
Turnier veranstalten ? Sie suchen nach einer Ergänzung zu den
Disziplinen wie Dressur und Springen, die auch den Großteil
der Gelände- und Freizeitreiter innerhalb Ihres Reitervereins
oder Ihres Reiterhofs anspricht ? Sie sind ambitionierter
Geländereiter, kennen das Gelände in der Umgebung Ihres
Reiterhofs in- und auswendig und haben auch einige
Reiterfreunde, die Ihnen bei der Organisation unter die Arme
greifen können ? Aber vielleicht wollen Sie einfach nur eine
Veranstaltung, bei denen allen Pferderassen, ob Großpferd,
Araber, Gangartenpferd oder Pony gleiche Chancen haben und
ohne Gefahr der Überforderung geritten werden können ? Oder
Sie wollen die Eignung einer bestimmten Pferderasse für den
wachsenden Markt der Freizeitreiter herausstellen ? Warum
veranstalten Sie dann nicht mal einen Distanzritt ??
Distanzritte und -fahrten sind im Unterschied zu
Freizeitreiterturnieren wie Rallyes und Orientierungsritte
durch die FN anerkannte Leistungsprüfungen und
Wettbewerbe und werden nach dem Reglement
des VDD (Verein Deutscher Distanzreiter u.
-Fahrer e.V) ausgetragen. Daneben sind Distanzritte als
Leistungsprüfungen der Zuchtverbände ZSAA und VZAP anerkannt.
Es gibt Einführungsritte (ab 25 KM), kurze, mittlere und lange
Ritte (40-160 KM) bis hin zu Mehrtagesritten, Distanzfahrten,
Markierte Ritte und Kartenritte, Ride& Ties, daneben gibt
es Seminare und Fortbildungsveranstaltungen.
Distanzreiten bietet für jeden etwas, egal ob Sport-,
Freizeit-, Gelände- oder Wanderreiter oder Besitzer von
Spezialpferderassen. Reiterlebnis und enge Verbundenheit mit
dem Pferd, Sport- und Naturerlebnis und dazu die
unvergleichliche Kameradschaft unter Distanzreitern, die aus
dem gemeinsamen Bewältigen einer gut ausgesuchten
Geländestrecke erwächst.
Zum Distanzreiter wird man durch Erfahrung und
Horsemanship. Aber wie wird man Distanzveranstalter
?
Voraussetzungen
Formal gibt es eigentlich keine bedeutenden
Voraussetzungen. Sie können als Verein oder Privatperson
veranstalten. Mitgliedschaft im VDD ist von Vorteil, aber
nicht Bedingung. Zu rechtlichen Absicherung der Veranstalter
ist zu sagen, daß der VDD für alle Distanzveranstaltungen eine
Veranstalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.
Gegebenenfalls besteht auch Versicherungsschutz über den
Landessportbund (Reitervereine). Besorgen Sie sich ein VDD-Reglement
(auf
der Website herunterladbar) und lesen Sie es durch. Sie
werden sehen, die Regeln lassen bei der Ausrichtung von
Distanzveranstaltungen einen weiten Gestaltungsspielraum. Die
allgemeinen Vorschriften der LPO, die für alle Wettbewerbe
gelten, finden auch für Distanzritte sinngemäß Anwendung. Der
VDD ist Anschlußverband der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) und damit eingebunden in
deren Rechtsstruktur. Im übrigen sind die Voraussetzungen aber
mehr praktischer Art.
Gelände und Strecke
Distanzritte werden auf einer Geländestrecke
veranstaltet, soviel ist klar. Künstliche Hindernisse und
Hürden sind nicht erlaubt, wohl aber natürliche Hindernisse
wie Bachdurchquerungen, Steilhänge usw. (Diese müssen in
angemessenem Abstand umgehbar sein). Das Geläuf
soll möglichst naturbelassen sein und den Pferdebeinen zuliebe
so wenig Asphalt- und Schotterwege enthalten wie möglich - und
natürlich landschaftlich reizvoll sein. Andererseits sind
Straßenüberquerungen, Siedlungen u.ä. in unserem
dichtbevölkerten Land manchmal unvermeidbar, besonders wenn
die Strecke auf ein ganz bestimmtes Ziel zuführt. Sicherheit
der Reiter und Pferde ist oberstes Gebot. Erfüllt Ihre
"Lieblingsstrecke" diese Anforderungen ?
Natürlich muß es auch erlaubt
sein, diese Strecke zu bereiten. In vielen Gegenden
herrschen strikte Reitbeschränkungen, die Sie kennen sollten.
Aber auch da gibt es fast immer Möglichkeiten, mit den
Verantwortlichen zu sprechen und sie davon zu überzeugen, daß
Distanzreiter keine Umwelt-Rowdys sind. Die Inanspruchnahme
der Wege durch die im Wettbewerb beteiligten Pferde dürfte nur
selten über die "normale" Belastung durch die gewöhnliche
Benutzung hinausgehen.
Eine Strecke mit möglichst logischem Verlauf (keine
oder wenige Schleifen) erleichtert sehr die Kontrolle, ob auch
alle Reiter die Strecke vorschriftsmäßig benutzen.

Lokale Infrastruktur
Fast immer werden Start- und Zielort identisch sein.
Haben sie nur eine kurze Strecke, veranstalten Sie eben nur
einen kurzen Ritt, oder lassen Sie sie von den Teilnehmern
zweimal reiten (mehr als zweimal kommt bei den Reitern nicht
gut an). Auch eine Kombination von verschiedenen "Runden" ist
möglich und oft reizvoll. Sehr beliebt bei Reitern (und auch
ihren Pferden) und von der Organisation vergleichsweise
einfach sind die "Post-Ritte", wo Hin- und Rückstrecke
identisch sind. Am schwierigsten, und etwas für erfahrerene
Veranstalter und Reiter, sind die Ritte "von A nach B" (also
Start- und Zielort nicht identisch).
Natürlich muß es an Start und Ziel eine gewisse "lokale Infrastruktur" geben, namentlich
ausreichend Platz für die Pferde, Graspaddocks, Hänger und
Fahrzeuge. Auch an die Versorgung der Reiter, sanitäre
Einrichtungen u.ä. sollte gedacht sein. Brauchen Sie
zusätzlichen Platz, bitten Sie einen Nachbarn um Hilfe. Wenn
er für Pferde etwas übrig haben, werden er Ihnen nichts
abschlagen.
Haben Sie Angst vor einer "großen wilden Horde" oder
müssen Sie platzmäßig Rücksicht nehmen und können nur eine
bestimmte Anzahl von Pferden verkraften ? Das kann ich gut
verstehen, mir ging es bei unserer Veranstaltung ebenso. Die
Lösung ist hier eine Teilnehmerbegrenzung (ab
20 Reitern). Hier geht es dann nach dem Motto "Wer zuerst
kommt (mit seiner Nennung), mahlt zuerst".
Auswahl der Stopps und Pausen
Bei jedem Distanzritt müssen mindestens drei Puls-Kontrollen auf der Strecke abgehalten
werden (bei Einführungsritten genügt eine weniger), meist mit
Pause (30 Minuten oder länger) vorzusehen. An diesen Stopps
kommen die Reiter in Gruppen oder kurzen Abständen je nach
Verlauf des Rittes an. Der Begriff "Stopp" legt es schon nahe:
es wird die Zeit (Reitzeit) der Teilnehmer angehalten, und
festgehalten (Eintrag in die Checkkarte und in die
Stoppliste). Nach Einlauf der Pferde müssen diese innerhalb
von 20 Minuten Puls 64 Schläge/ Minute erreichen oder
unterschreiten. Der Puls wird gemessen sobald die Teilnehmer
sich hierzu melden, in der Regel direkt bei bzw. wenige
Minuten nach Eintreffen.
In der Regel werden die Betreuer der Reiter diese
Punkte ansteuern, um die Pferde zu pflegen und die Reiter
aufzumuntern.
Es ist besonders wichtig, daß diese Plätze gut ausgewählt
werden. In erster Linie ist auf geeignete Anfahrtsmöglichkeit
und ausreichend Platz für Fahrzeuge (für Helfer und Tierärzte,
Pferdetransporter, Betreuungsfahrzeuge) zu achten. Der Platz
zur Untersuchung der Pferde ist besonders zu kennzeichnen und
freizuhalten. Ein fester Weg mit möglichst ebenem Belag (am
besten Asphalt) muß zum Vortraben der Pferde vor dem Tierarzt
vorhanden sein.
Für die Pferde wichtig, soll der Platz ihnen Schutz vor
Sonne, Platz zum Ausruhen und Stallen und etwas Gras bieten.
Windbestrichene Plätze auf den Höhen sind geeigneter als enge
Täler, in denen die Luft steht, denn die Pferde werden oft
erhitzt sein - das wussten schon vor über 100 Jahren
Veranstalter von Jagden, und dies gilt auch für Distanzritte.
Bereitstellung von Tränkwasser (am besten in
großen Bottichen) ist ein Muß! Bei Regenwetter sind Hallen
oder Gebäudevordächer nicht zu verachten. Möglichkeiten zum
Anbinden (Bäume) sind wünschenswert. Versorgung der Reiter
(heiße und kalte Getränke, Essen je nach Tageszeit) ist für
eine gutorganisierte Veranstaltung eine
Selbstverständlichkeit.
Je mehr Ihr Stop-Platz diese Ideal-Anforderungen
erfüllt, desto besser und genauer können Ihre Helfer und
Tierärzte hier arbeiten. Chaos und Unruhe an den Stopps zu
vermieden, ist ein wesentliches Element guter Organisation
eines Distanzrittes !

VetGate oder Pause?
Nachdem die Pferde Puls 64 gemessen und untersucht
sind, beginnt meist die (für alle gleich lange) Pause. Die
Vorstellung ist, dass der Reiter vom markierten
Untersuchungsplatz in die Pause geht, wie durch ein Tor (VetGate).
In der Regel behält der Stoppleiter (oder Stopp-Schreiber)
die Checkkarten der Reiter, und gibt sie zum Weiterritt wieder
heraus. Man sollte in der Bemessung der Pausen nicht zu
großzügig, aber auch nicht zu knausrig sein. Die Pausendauer
kann entsprechend des aktuellen Wetters auch am
Veranstaltungstag bis zum Eintreffen des ersten Reiters noch
geändert werden (durch Stoppleiter und Tierarzt). In der Regel
sind 30 Minuten voll ausreichend, denn die Pferde kamen ja
bereits mit Puls unter 64 aus dem Gate. Früher wurde die
Erholzeit bis Puls 64 zur Pause mitgezählt, man machte
"Pausen" anstatt "VetGates". Nachdem VetGates jetzt
schon fast 30 Jahren üblich sind, sollten sich alle
lange daran gewöhnt haben, und "Pausen", wo manche Pferde erst
20 Min. stehen, bis 64 erreicht ist, und sie dann nach 10 Min.
vielleicht schon wieder weiter müssen, gar nicht mehr
veranstaltet werden, oder zulässig sein! Solche Fälle waren
damals der Grund, VetGates einzuführen. Alle Veranstalter,
auch solche mit wenig Helfern, sind in der Lage VetGates zu
organisieren. Zugegebenermaßen, bei Zeitnahme in Sekunden
steigt der Aufwand nicht unerheblich. Für 99% der Ritte ist
die Zeitnahme in Minuten aber ausreichend und
angemessen, und sorgt für weniger Stress und mehr
Zufriedenheit bei allen Beteiligten.
Kontrollen auf der Strecke
Außer VetGates kann es unangekündigte
Kontrollen auf der Strecke geben, bei denen die Pferde
nur Puls 72 (innerhalb von 10 Minuten) erreichen müssen. Bei
den Reitern heißen sie "Radarfallen", weil sie zu schnelles
Reiten stoppen sollen. Die Zeit wird hier nicht angehalten.
Größere Untersuchungen finden hier nicht statt.
Anfahrtsmöglichkeit ist meist nur für Helfer (ggf. für
Tierärzte) vorzusehen. Tränkwasser muß aber vorhanden sein.
Hier kommt es im allgemeinen auf Schnelligkeit in Sekunden an.
Aber auch hier gilt, dass direkt vor, oder in der
Kontrolle maximal 20 Minuten vergehen dürfen, bis das Pferd
Puls 64 erreicht hat. Daher sollte auch an den Radarfallen die
Pulsmesser die Reiter zügig "hereinwinken" und die Zeit der
ersten Messung eintragen.
Auch unterwegs sollte die Strecke überwacht werden,
insbesondere an schwierigen, unklaren oder zum "Abkürzen"
reizenden Streckenabschnitten. Die Strecke (und Streckenlänge)
ist verbindlich! Für Reiter, aber auch für Veranstalter
(Angabe der Streckenlänge) - aus Gründen der Fairness und
Vergleichbarkeit. Falls Markierung nicht auffindbar ist, ohne
langes Herumreiten und Suchen, gilt im Zweifelsfall die
Streckenkarte. Diese muss daher aktuell sein,
d.h. die tagesaktuell markierte Strecke muss eingetragen sein
(ggf. werden die Reiter gehalten evtl. Änderungen des
Streckenverlaufs in ihren Kartenkopien nachzutragen), und die
Kartengrundlage selbst darf nicht zu alt sein (insbesondere
alle neugebauten Straßen müssen verzeichnet sein, zur Not
ebenfalls per Hand, da dies große Verwirrung stiften kann).
Die Sicherung gefährlicher Straßenübergänge wird
empfohlen (für diesen Dienst lassen sich evtl. Hilfsdienste
wie ASB, Malteser, THW o.a. gewinnen).
Markierung und Streckenlänge
Wollen Sie Ihre Strecke markieren oder
nach Karte (bzw. Smartphone/GPS) reiten
lassen ? Nach Markierung zu reiten, ist für die Reiter
einfacher, aber das Ausbringen der Markierung ist ein
erheblicher Aufwand für den Veranstalter. Mit welchem Material
wollen Sie markieren ? Eine der sichersten, weil von Dritten
kaum veränderbare Art ist die Kalkmarkierung. Hierbei werden
deutlich sichtbare Punkte aus gelöschtem Kalk ausgebracht.
Nachteil: Mühsam auszubringen; zwingt den Reiter, ständig auf
den Boden zu schauen.
Sehr gut sind auch Markierungspfähle, oder Kreppband
(im Wald). Bedingt zu empfehlen sind Schilder (leicht zu
verändern!) und Plastikband. Farbe wäre an sich gut, ist aber
meist nicht zulässig.
Zuchtverbände verlangen zur Anerkennung der
Leistungsprüfung markierte Ritte. Anscheinend gehen sie
von der Voraussetzung aus, dass unmarkierte Strecken keine
echte Gewähr bieten, dass die KM auch tatsächlich stimmen.
Es wäre Sache des VDD, genauer der Regionalbeauftragten, hier für
Ordnung zu sorgen. Schließlich gibt es auch eine gemeinsame
KM-Wertung, und bei den Leistungsprüfungen der Zuchtverbände geht
es um Punkte, in deren Berechnung die KM oft doppelt einfliessen,
und für viele auch um Geld. Da wäre es wichtig, in allen Fällen
korrekt zu sein. Es ist leider ein offenes Geheimnis, dass es
Ritte gibt, wo die 81 KM oft eher nur 61 sind, und leider sind
diese Ritte beliebter unter den Reitern, als solche die mit 66 KM
ausgeschrieben werden, aber 71 lang sind! Beides ist unschön und
unzulässig, denn die Strecke darf nur bis maximal 5% abweichen.
Mit den heutigen computermäßigen Hilfsmitteln (wie z.B. BRouter)
ist das unschwer und in kurzer Zeit nachzumessen!
Ritt-Organisation und Helfer
Ohne ausreichende Zahl qualifizierter, motivierter
Helfer kein Distanzritt !
Zunächst ist eine Menge Arbeit im Vorfeld der
Veranstaltung zu erledigen, die möglichst auf mehr als zwei
Schultern verteilt werden sollte: Abreiten und Markieren der
Strecke, Einholen der Genehmigungen, Erstellen der
Ausschreibung, Rittsekretariat, Information der lokalen
Presse, Herrichten von Start, Ziel und Stops, Erstellen von
Rittkarten, Checkkarten für die Reiter, Teilnehmerlisten uvm.
Wieviele Helfer Sie während des eigentlichen
Wettbewerbs brauchen, hängt von der Anzahl der Reiter, aber
auch den Details der Veranstaltung ab. Sie (oder der Sportliche
Leiter) übernimmt die Einteilung der für den Ritt
benötigten Helfer nach Zeit und Ort. Im Regelfall braucht man
am 1. Stop die meisten Helfer (und den meisten Platz), weil
die Reiter zu Anfang des Rittes noch in größeren Gruppen
reiten und in kürzeren Intervallen ankommen.
An jedem Stop brauchen Sie einen Stoppleiter,
der sich auskennt, den Überblick behält und "die Sache im
Griff" hat. Als seine "Vertreter vor Ort",
weisungsbefugt i.S. der LPO (ähnlich Richtern bzw.
nach FEI: Ground Jury) werden diese
bei der Vorbesprechung den Reitern namentlich benannt gemacht,
ebenso wie die Tierärzte. Dieser ist am Platz der wichtigste
Mann oder Frau, kommt als erster und fährt als letzter, teilt
die anderen Helfer ein, soweit noch nicht geschehen, legt fest
wo genau gemessen und Zeit genommen wird, und führt (wobei er
Ein- und Auszeitnahme an andere, feste Personen abgeben kann)
die Stoppliste, weiß also genau welche Reiter wann
gekommen, wieder geritten oder ausgeschieden sind, und in
welchem Zustand (laut Tierarzt oder eigenem oberflächlichen
Eindruck) die Pferde waren. Welches Tempo ritten sie, T4 oder
5? Haben andere Helfer Fragen, fragen sie den Stoppleiter.
Gibt es vorort Probleme, löst der Stoppleiter sie. Schaut der
Chef (Sportliche Leiter) vorbei und fragt nach etwas, was am
Stop passiert ist, der Stoppleiter weiß es und gibt Auskunft.
Er muß selber nicht reiten oder Puls messen können - wenn
er es kann, misst er auch mal einen größeren einlaufenden
Pulk mit - aber ein Gefühl für Veranstaltungen, Abläufe und
"Ordnung" sowie natürliche Autorität haben. Versucht etwa
einer der Troßfahrer im Eifer des Gefechts, auf der
Vortrabstrecke zu parken oder ähnliches (auf der
Vorbesprechung hat der Sportliche Leiter verkündet wo geparkt
wird, aber der entsprechende Troßfahrer war nicht dabei oder
hat nicht zugehört), der Stoppleiter sieht es gleich, und wird
ihn mit freundlichen aber an Deutlichkeit nicht fehlenden
Worten dazu bringen sein Fahrzeug umgehend woanders
abzustellen, und wird es nicht etwa erst dann bemerken, wenn
das Fahrzeug dort schon 5 Min. steht und sein Fahrer nicht
mehr auffindbar ist. Nicht ist dies die Aufgabe des Tierarztes
oder der jüngsten Pulshelferin. Ist der Stop groß und gibt es
genug Leute, sollte der Job an spezielle Einweiser
übergeben werden, soviel ist klar. Ist der Stop jedoch klein,
weil auf einem langen Ritt am vorletzten oder letzten Stop nur
alle halbe oder Stunde ein Reiter durchkommt, machen ihn der
Stoppleiter zusammen mit dem Tierarzt vielleicht nur zu zweit.
Zwei Arten von Leuten eignen sich zu Stoppleitern: Erstens die
wahren Manager/Macher/Organisierer mit Ortskenntnis. Zweitens
die erfahrensten Distanzritt-Helfer mit Überblick, die dann
nur fragen "Wo ist meine Liste, und wo ist meine Karte?".
Es ist unabdingbar - und im Zeitalter des Mobiltelefons auch
unproblematisch - dass er telefonisch erreichbar ist, um z.B.
die Frage zu beantworten "welche Reiter sind bei Euch noch
nicht rein gekommen?" Er ist der Mann oder die Frau, um die
Tierärzte von solch "organisatorischen Kram" freizuhalten.
Klar gibt es welche, die hieran auch Freude haben. Aber ein
guter Tierarzt ist vielleicht kein gutes Organisationstalent,
bzw. jeder Tierarzt macht, wenn viel los ist, doch lieber
seinen eigentlichen Job. Der Stoppleiter hält ihm dafür den
Rücken frei. Beide sind prinzipiell gleichgestellt, und
zusammen als Team unschlagbar. Der Tierarzt ist für das
"Chaos", der Stoppleiter für die Ordnung zuständig...

Rittbüro (Sekretariat) und Organisationsstruktur
Von wem hat der Stoppleiter die aktuelle Stopliste
bekommen, sein wichtigstes Hilfsmittel, auf der alle Reiter,
die am heutigen Tag losgeritten sind, verzeichnet (und die
nicht gestarteten schon gestrichen) sind? Natürlich vom Rittbüro,
oder dem Sportlichen Leiter (was dieselbe Person sein
kann). Beim Rittbüro (Meldestelle) meldet sich jeder Reiter
beim Eintreffen auf dem Ritt an und entrichtet sein Startgeld,
erst damit ist er "offiziell da". Beginnt der Ritt, übergibt
es an den Sportlichen Leiter, und - wenn es keine eigene
Stelle (Person) hat - ist während des Rittes meist
geschlossen. Das Rittbüro hat heute - d.h. seit etwa 20 Jahren
gehört dies zum Standard - einen tragbaren Computer,
Tabellenkalkulation zum Überblick der Reitzeiten, und kleinen
Drucker, damit der Sportliche Leiter in die Lage kommt zu
wissen, wann er welche Helfer wo abziehen und an einen anderen
Stop schicken kann. Der Job des Stoppleiters am Ort X endet
mit dem Auflösen des Stops und seiner Listenübergabe an den
Sportlichen Leiter. Im Ziel hat die Ein-Zeitnahme
entsprechende Aufgaben, sammelt die Ankunftszeiten aller
Reiter und meldet sie ebenfalls dem dann wieder geöffneten
Rittbüro/ Sportlichen Leiter. Für Rittbüro, Stoppleiter,
Streckenchefs und Zeitnahme braucht es nicht unbedingt
Leute die von Distanzreiten viel verstehen, wenn sie nur - vom
Versanstaltungs-Chef und Sportlichen Leiter - richtig
eingewiesen sind. Aus all dem ergibt sich eine hierarchische
Organisationsstruktur, mit den Stoppleitern als mittlere, den
Sportlichen Leiter entlastende Ebene. Sie ist strikter
hierarchisch bei unsicherem Helfer-KnowHow, oder/und
Veranstaltern die im Prinzip alle Vorbereitungen in eigener
Person treffen, und breiter verteilt bei breit verteiltem
KnowHow und Aufgaben.
Ritt-Vorbesprechung (Reiter und Helfer)
Die Reiter erwarten mit Recht, vor dem Ritt zur
vorgegebenen Zeit (siehe Ausschreibung) alle Besonderheiten
des Rittes, der Strecke, der Stops und eventueller Troßpunkte
erklärt zu bekommen. Fürs Erklären zuständig ist der
Sportliche Leuter sowie (falls vorhanden) der oder die
Streckenchefs. Hier ist wichtig, dass alle anwesend sind und
zuhören: Reiter, Troßfahrer, Helfer und Tierärzte. Es ist
stets sinnvoll, die Vorbesprechung eine Viertelstunde vorher
laut anzukündigen, besonders wenn sie an einem anderen Ort als
dem zentrallen Ritt-Treffpunkt stattfindet. Anschlüsse für
Beamer, Computer etc. sind hierfür heute meist wünschenswert.
Direkt im Anschluss sollte die Helfer-Vorbesprechung mit
endgültiger Helfer-Einteilung, Einsatz- und Fahrtplänen
erfolgen, der Übergabe der Stop- und KP-Listen zum Eintragen
der Reiter etc. Das Rittbüro hat hierfür vorgearbeitet. Die
Helferbesprechung ist insbesondere wichtig, wenn der
Sportliche Leiter mehr oder weniger die Rittvorbereitungen
allein durchgeführt hat, um die Helfer alle in genauen
Kenntnisstand zu setzen, damit jeder genau weiß was seine
Aufgabe sein wird, und an wen er sich bei Fragen wenden kann.
Selbst der Küchenmeister, wenn er am ganzen Ritttag über
vorort verbleibt, sollte hieran teilnehmen, und in der kurzen
Zeit den Grill an einen Vertreter übergeben.
Weitere Helfer und Aufgaben
Zum Pulsmessen der Pferde benötigen Sie als
Veranstalter Pulshelfer (früher auch:
P/A-Helfer geannt, Abkürzung für Puls/Atem, heute werden die
Atemwerte in der Regel nicht mehr gemessen). Deren Aufgabe ist
es, die Pulswerte des Pferdes mit Stethoskop und Uhr zu
messen, in die Checkkarte einzutragen und ggf. den Tierarzt
auf besondere Beobachtungen aufmerksam zu machen. Das ist
alles keine Hexerei, ein routinierter Geländereiter, gleich
welchen Alters, kann es an einem Nachmittag erlernen. Fragen
Sie erfahrene Distanzreiter, die Sie kennen, sie werden Ihnen
sicher gerne helfen (wenn sie nicht selber mitreiten wollen).
Besuchen Sie einen P/A-Helfer-Lehrgang (sie
werden in unregelmäßigen Abständen veranstaltet, fragen Sie
Ihren VDD-Regionalbeauftragten) oder, wenn Sie mehrere Leute
in Ihrem Verein haben, die sich für diese Aufgabe
interessieren, fragen Sie einen erfahrenen Veranstalter oder
Distanz-Trainer. Er wird sicher gern einen Nachmittag opfern,
um bei Ihnen einen Kurs zu geben.

Wenn der Veranstalter nicht selbst in Person die
Strecke am besten kennt, wird er außer dem Sportlichen
Leiter noch einen Streckenchef haben, ggf. auch
mehrere für unterschiedliche Teilabschnitte, die z.B. auch
Streckenmarkierungen vorgenommen und genaueste Ortskenntnis
haben. Diese werden wichtig sein, um z.B. Leute von der Presse
oder Fotografen einzuweisen. Für jeden Helfer muss es einen
Einsatzplan mit genauer Ortsbeschreibung (wenn möglich mit
Fahrplan; hat er eigenen PKW oder fährt irgendwo mit?) geben.
Die Presseleute betreut man als Veranstaltungs-Chef nach deren
zeitlichen Möglichkeiten am besten selbst, bzw. nimmt sie
einfach mit und erzählt ihnen dabei das wichtigste. Eine
vorbereitende Pressemappe ist dabei sinnvoll (bzw. heute meist
per e-Mail zu senden). Ist die ganze Rittorganisation
unterwegs und kommt erst kurz vor den ersten Reitern
nachmittags zurück, sollte vielleicht der zurückbleibende Ground
Marshall oder Küchenmeister nicht nur ein Auge
auf das Gelände haben, sondern auch Fragen beantworten können
von vielleicht eintreffenden Zuschauern, wo denn all die
Reiter hin sind, von denen man in der Zeitung gelesen hätte.
Zumindest ein Hinweis auf die groß aushängende Streckenkarte
geben, und wo sie sich die meisten derzeit vermutlich
befinden.
Ein Fotograf sollte sich um stimmungsvolle
Bilder der Reiter bemühen. Dieser benötigt eine Systemcamera
und mindestens eine Langbrennweite oder Telezoom (ab
200-300mm). Gute Bilder ohne häßliche Hintergründe,
Asphaltwege etc. Distanzreiten als naturnahen Sport und die
Schönheiten dieses speziellen Rittes zeigen, denn es gibt ja
viele Veranstaltungen. Was macht Ihre so besonders? Dieser Job
ist so wichtig, dass die Einweisung in jedem Fall durch den Streckenchef
erfolgen muss. Reiter sollten Bilddateien kostenfrei
bekommen, zumindest eine bestimmte Anzahl, in reduzierter
Auflösung und mit Fotografenstempel.
Natürlich muß sich jemand um Essen und Getränke
kümmern, das unterscheidet Distanzreiten nicht von anderen
Veranstaltungen. Ein Fahrer mit Transporter
sollte bereitstehen für ausgeschiedene Pferde und ggf. Notfallfahrten (vorher Bereitschaft der
nächsten Tierklinik sichern!). Hierzu gehört, daß der Fahrer
oder einer der Tierärzte mittels Mobiltelefon
(früher war Funk die Regel) erreichbar ist. So wichtig deren
Jobs sind, sollten sportliche Leiter nicht selbst stundenlang
Frühstücksbrote schmieren oder ausgeschiedene Pferde
zurückfahren. Dann fehlen sie für andere, Lokalkenntnis und
Entscheidungen erfordernde Aufgaben, und der Ritt gleitet
schnell ins Chaotische ab. Eine gute Regel ist, dass der Sportliche
Leiter nicht selbst sich für eine Aufgabe an einem
festen Ort einteilt, sondern "mitschwimmt",
überall nach dem Rechten sieht und schaut dass alle ihren Job tun
können. Natürlich auch an den Kontrollposten. Diese
benötigen ebenfalls eine tagesaktuelle Starterliste zum Abhaken
und Zeiten notieren. Auch Jugendliche, die man an solchen Stelle
gern postiert, wird man nicht ohne Wasser, Kuchen o.ä.
Verpflegung, und heutzutage Handy aussetzen bzw. postieren.
Tierärzte
Zusammen mit den Stoppleitern sind die Tierärzte
die wichtigsten Helfer. Ihr Status ist ein
besonderer: Sie untersuchen alle teilnehmenden Pferde
mehrmals während des Rittes (Voruntersuchung, mehrfach auf
der Strecke, und Nachuntersuchung) und beurteilen dabei die
Reittauglichkeit der Pferde. Von allen anderen sind
sie zu unterstützen damit sie gute Arbeitsbedingungen haben.
Sie werden zur Not auch bei strömendem Wetter im Regen stehen
und Pferde untersuchen, wenn alle anderen Helfer sich in
schützende Deckung flüchten. Aber besser ist es (und erhöht
ihre Bereitschaft auch noch Ihren nächsten Ritt mitzumachen),
sie bekommen einen Regenpavillon aufgebaut, haben ein
schützendes Vordach einer Scheute etc. Vorgeschrieben sind je
angefangene 30 Starter mindestens ein Tierarzt, wobei man
immer besser mehr als einen hat.
Ihre Hauptaufgabe ist es, alle teilnehmenden Pferde
sorgfältig, fair, und nach bestem fachlichen Wissen zu
beurteilen. Wenn Sie dabei zu dem Ergebnis kommen, ein
bestimmtes Pferd könne eine vor ihm liegende Strecke (z.B. 20
KM bis zur nächsten Kontrolle) nicht schaffen ohne Schaden zu
nehmen oder Schmerzen zu erleiden (weil es z.B. eine leichte
Lahmheit zeigt), darf das Pferd den Ritt nicht fortsetzen, der
Tierarzt muß es "aus dem Rennen nehmen". Die Entscheidungen
des Tierarztes sind unanfechtbar. Wie der
Reiter sein Pferd von dort fortbekommt ist dann erst mal sein
Problem. Reiten oder eine längere Strecke führen wäre
unzulässig.
Es versteht sich von selbst, daß der Veranstalter alles
tun muß, um die Tierärzte in dieser schwierigen Aufgabe und
ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen.
Jegliche Versuche, sollten sie wirklich vorkommen, den
Tierarzt zu beeinflussen, müssen Veranstalter wie Stoppleiter
schon im Ansatz unterbinden, wo dies meist noch mit
freundlichen Worten möglich ist. Der Veranstalter muß aber
auch alles tun, um mögliche Befangenheit des
Tierarztes auszuschließen. Das ist regelmäßig auch dann
schwierig, wenn er eigene Pferde starten lässt.
Natürlich darf er diese schwierige Aufgabe nur
Tierärzten übertragen, deren sehr guter Pferdefachkenntniss
und sicherem Urteil der Veranstalter traut.
Um hier zu unterstützen, gibt der VDD eine Liste erfahrener
"Distanztierärzte" heraus (bei der VDD-Geschäftsstelle
erhältlich). Meist ist es sinnvoll, junge und erfahrene
Tierärzte gemeinsam einzusetzen. Wo ein einzelner Tierarzt
eingesetzt ist, ist es immer sinnvoll, und ein Zeichen von
Stärke und keineswegs von Schwäche, dass dieser sich zur
Bestätigung "kritischer" Urteile den Sportlichen Leiter oder
Stoppleiter hinzuruft. Soviel Zeit ist immer, ein "fragliches"
Pferd 2x vortraben zu lassen. Erfahrene Distanztierärzte
wissen dies, und schätzen wenn der Veranstaltungs-Chef sie
hier bestätigt (4-Augen-Prinzip), den anderen wird dieser es
im Zwiegespräch vor dem Ritt kurz erläutern.
Damit der Tierarzt zügig arbeiten kann, muss er von
Schreibarbeiten freigehalten werden, benötigt also einen
Schreiber, der alle Werte und Befunde in die Checkkarten
einträgt. Wichtiger als eine schöne Schrift ist für den Tierarztschreiber die Kenntnis der Checkkarten
und der tierärztlichen Terminologie. Das ist ein abwechslungs- und lehrreicher
Job der zudem noch hohe Aufmerksamkeit und ein gutes Gehör
verlangt. Der Schreiber weicht seinem Vet nur von der Stelle,
wenn dieser auf Toilette geht, oder ihn anderweitig
dispensiert.
All diese Dinge müssen nicht etwa aus Perfektionismus
oder Pedanterie verlangt werden, sondern weil im Interesse der
Gesundheit der teilnehmenden Pferde und der sportlichen
Wertung eine geordnete, faire und fachkundige tierärztliche
Überwachung auf Distanzritten unverzichtbar ist!

Finanzen
Wenn Sie das nun alles gelesen haben, können Sie
vielleicht zu dem Schluß kommen, daß Distanzveranstaltungen
eine Menge Arbeit machen, Geld kosten und der Vereinskasse
kaum etwas einbringen. Aber das ist nicht der Fall. Es mag
leichtere Mittel und Wege geben, um einen Reiterverein
finanziell zu konsolidieren. Aber darum geht es nicht, und es
gibt nicht nur Ausgaben, auch Einnahmen:
Die Teilnehmer zahlen im Schnitt DM 1,20 pro KM der Strecke,
d.h. für einen 50-KM-Ritt DM 60,-- an Nenn- und Startgeld. Bei
40 Teilnehmern ergibt dies immerhin DM 2.400,--.
Davon gehen ab Tierarztkosten (Gebühr ca. DM 300,-- bis
400,-- pro Tierarzt), Verpflegung und Getränke für Reiter,
Ehrenpreise und Stallplaketten, Benzingeld für Helfer, dazu
Kosten für Markierungsmaterial und Karten, Genehmigungen,
Gebühren von VDD und FN (geringfügig). Ein Überschuß dürfte
also bei einem gut besuchten Ritt leicht zu erwirtschaften
sein.
Hinzu können weitere Einnahmen kommen, die nur von
Ihrer eigenen kaufmännischen Tüchtigkeit abhängen: Für Essen
und Getränke, auch für Zuschauer, eventuell lokale Sponsoren
oder solche aus dem Reitsport usw. (Fernsehrechte sind halt
leider noch selten beim Distanzsport.)
Großveranstaltungen rechnen in anderen Dimensionen: Bei
einer Deutschen Meisterschaft im Distanzreiten (160 KM oder
Zweitagesritt) liegen Ausgaben und Einnahmen im Bereich von DM
50.000,-- oder mehr, bei internationalen Meisterschaften noch
wesentlich höher. (Anm.:
Geschrieben war der Artikel noch zu DM-Zeiten - Heute
wohl 1:1 in Euro?)
Reich wird man also nicht als Veranstalter. Aber genügt
es nicht zu sagen, "die Sache rechnet sich", oder "die
Vereinskasse hat ein kleines Plus gemacht" ? Machen wir, als Pferdeleute,
das ganze nicht sowieso mehr oder weniger aus Idealismus
? Nach so einem Ritt haben die, die dabei gewesen sind,
besonders wenn es ihr erster Distanzritt war, noch lange zu
erzählen. Weißt Du noch, an dem und dem Stop..? - So ein Ritt
ist für jeden Verein eine tolle Sache zur Identitätsstiftung,
was ebenso wichtig ist wie dass die Vereinskasse noch stimmt.
Kommen wir ins "doing"
Aller Anfang ist leicht. Sie haben eine Idee
für Ihren Ritt - es genügt nicht, einfach zu reiten, Sie
müssen eine Idee haben, die die Leute fesselt
und neugierig macht. Sie haben, als passionierter
Streckenreiter, eine Strecke gefunden, aufgezeichnet und
abgemessen auf Karten im Maßstab 1:25.000. Sie haben Helfer,
die sie mitreißen könne, sowie einen Start- und Zielort.
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem VDD-Regionalbeauftragten
(LK-Beauftragten) auf, die auch für Fragen aller Art zuständig
sind.
Entwerfen sie eine Ausschreibung (vom
VDD gibt es ein Formular hierzu). Der VDD bietet auch
Formulare mit Veranstalter-Tips und solche für Ritt-Tierärzte
(zu beziehen bei der VDD-Geschäftsstelle). Lesen Sie das
Reglement. Mitglied im VDD zu sein, ist für Veranstalter eine
große Erleichterung.
Kommen Sie zum jährlichen Veranstaltertreffen. Hier
gibt es wichtige Tips und Hinweise, werden
Veranstaltungstermine abgestimmt und reserviert, und neue
Entwicklungen werden diskutiert. Oder gehen Sie zu einem Ritt,
der schon seit Jahren veranstaltet wird, schauen sich um und
holen sich Tips.
Wer es erlebt hat, wird mir
zustimmen: Es gibt kein schöneres Erlebnis als ein schöner, gut
organisierter Distanzritt mit dem eigenen Pferd. Außer, man
hilft dabei, solch einen Ritt selbst mit zu veranstalten, und
freut sich an der Freude der anderen - das ist das
Größte...
Anmerkungen:
Ich habe den Aufsatz ursprünglich mal vor etwa 25 Jahren als
VDD Regionalbeauftragter verfasst; veröffentlicht wurde er in
UNSER PFERD - Zeitschrift des Hessischen Reit- und
Fahrverbandes. Zuletzt
aktualisiert 2022: meine
(gemischtsprachliche) Schreibweise der Stops und Stopleiter
hat sich nicht durchgesetzt, daher habe ich dies korrigiert.
Wohl die wenigsten Veranstalter haben eine aktuelle LPO (falls
sie wirklich nötig wäre, sollte der
Regionalbeauftragte sie haben). Und nachdem wir 1994
die ersten VetGates veranstalteten (damals als
"verschärfende Tierschutzbestimmungen") und sie seit, wie ich
glaube, 1996 im Reglement fest verankert sind, scheint es
immer noch Veranstalter zu geben, die "Pause machen".
Und auch die Kilometer stimmen auf vielen Veranstaltungen
notorisch immer noch nicht, wobei nicht immer nach unten,
teils auch nach oben abgewichen wird.
- zurück zur
Hintertaunus-Distanz -
- zurück zur Homepage -