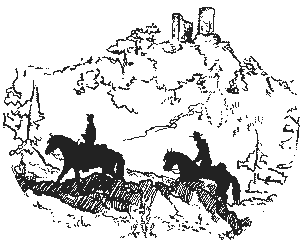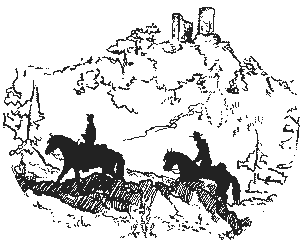 |
TAUNUSREITER
(c) Frank Mechelhoff
2001-2013 - Kopien speichern nur zum
privaten Gebrauch zulässig
Verwendung
der
Bilder und Texte in eigenen Websites oder zu
geschäftlichen Zwecken ohne meine schriftliche
Genehmigung nicht gestattet (Hinweise
zum
Copyright)
Kontakt: taunusreiter  yahoo.de yahoo.de
Erstellt
Dez. 2015
|
Spezielles zur Pferdefütterung
Es ist möglich, das Pferd an allerlei Futtermittel zu gewöhnen,
und die Flexibilität des equiden Verdauungssystems ist so hoch,
daß binnen weniger Tage die Umstellung von einer Getreidesorte auf
eine andere, oder Heu auf Silage oder Grummet, ohne Koliken u.ä.
Krankheitszeichen möglich ist. Das heißt nicht, dass alle
Futtermittel bei denen das Pferd keine Kolik bekommt auch gesund
und langfristig unschädlich sind, sondern nur, dass in der
Natur Umstände auftreten können, unter denen das Pferd gezwungen
ist, anderes, als das gewohnte und bestgeeignete Futter
aufzunehmen.
Das bedeutet, umgekehrt wird kein Schuh draus. Z.B. das
vielzitierte Beispiel der Fischreste vom Strand auflesenden
Islandponies beweist nur, dass es Pferde gibt, die zumindest nicht
gleich zugrunde gehen wenn sie Fischreste fressen, weil sie
vermutlich keine andere nährstoffreiche Nahrungsquelle finden. Es
beweist nicht, dass Pferdefütterung mit Produkten tierischen
Ursprungs etwa artgemäß, oder auf Dauer unschädlich wäre: Das
Pferd ist von den Zähnen an, über Magen und Darm ein reiner
Pflanzenfresser. - Alle Versuche die z.B. vom Militär
angestellt wurden, das Pferd mittelst künstlich hergestellter,
konzentrierter Futtermittel zu ernähren - es war den ranghohen
Militärs sehr bewußt, wie schwierig es im Kriege werden kann,
Nachschub an Heu mitzuschleppen oder zu transportieren, man
versuchte also alles mögliche um Ersatzfuttermittel zu testen,
einzuführen und wenn möglich im Frieden schon anzulagern -
scheiterten bereits vor 100 Jahren ausnahmslos. Und zwar selbst
dann, wenn diese Futter dieselbe oder noch höhere Mengen an
Nährstoffen erhielten, wie die naturgemäßen. Es stellte sich
heraus, dass es keine geeignetere und kostengünstigere
"Futterkonserve" gab, als das Haferkorn mit seinem naturgemäßen
Schutz aus Spelze. Und in der Tat nannten alle fischfressende
Ponies erwähnenden Berichte besondere Umstände wie dauernden
Rauhfutter- und Grasmangel, Winter und Notzeiten.
Unproblematisch ist hingegen bis heute alles, was sich das Pferd
bei freier Auswahl in der gewohnten Umgebung selbst sucht,
also frische Blätter, besondere Kräuter, Wurzeln usw., weil es
hier die freie Auswahl hat. Sobald es eingestallt ist,
oder auf einem Beton- und Graspaddock steht, hat es diese Auswahl
nicht mehr. Und weil es einen nur kleinen Magen hat, ist es auf
dauernden Futternachschub angewiesen, wird also, wie jeder Reiter
weiß der einmal länger als zwei bis drei Stunden im Gelände
geritten ist, schnell hungrig, und frißt dann, was es findet oder
ihm vorgesetzt wird.
Auf diese Art entwickelt das Pferd, dem Weide genügender Größe und
Futter-Abwechslung zur Verfügung stehen, mit der Zeit eine
erhebliche Erfahrung von Gesundem, weniger Gesundem, Giftigem und
Heilkräutern. Das auf großen Weiden gehaltene Pferd therapiert
sich so selbst, ohne dass sein Besitzer von der Krankheit
überhaupt etwas mitbekommt. In einer fremden Umgebung kann das
Pferd nichtsdestotrotz Giftpflanzen in schädlicher Menge
aufnehmen, denen es zuvor noch nie begegnet war.
Silage ist kein Pferdefutter (Prof. Helge Böhnel,
Göttinger Institut für Tropentierhygiene). In der Natur
findet das Pferd keine vergorenen Futtermengen, frisst sie auch
nicht, und kann mangels Erfahrung nicht zwischen bekömmlich und
schädlich unterscheiden. Selbst der Mensch, unter Zuhilfenahme
seines viel besseren Verstands, kann sich bei der Beurteilung von
Silage sehr leicht in der Qualität täuschen, während die
Beurteilung von Heu, Hafer und anderen Getreidearten unkompliziert
grobsinnlich (Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken) möglich ist. An
solche sollten wir Pferdehalter uns daher halten, und
vergegenwärtigen dass ein gezahlter kleiner Aufpreis für gute
Qualität eines lokal bekannten, vertrauenswürdigen Lieferanten
hundertfach günstiger ist, als die Behandlung einer, im Falle von
Fütterungsfehlern meist chronischen, Erkrankung!
(Artikel:
Silage, das Unfutter, von Susanne Weyrauch)
Aus all diesen Gründen sollen alle Futtermittel, deren
Zusammensetzung nicht auf Anhieb klar sind oder die industriell
stark verändert sind, gemieden werden. Müsli-Mischungen,
deren Ausgangsprodukte deutlich erkennbar sind, sind besser als Pellets
die nur gefüttert werden sollten, wenn sie von einem
Spitzenhersteller stammen, und eine Deklaration nicht nur der
Inhaltsstoffe sondern der vollständigen Herkunft vorliegt (bei
diesen Pellets gibt es allerdings keinen Preisvorteil mehr).
Die Gesamtration (=Kraftfutter, Beifutter, Heu bzw.
wahrscheinliche Grasmenge) sollte berechnet und ausbalanciert
sein. Bekanntlich wirkt zuviel Getreidefutter in mancherlei
Hinsicht schädlich. Um dies zu verhüten ist die Beschaffung der
Futterstoffe in bester Qualität nötig und die Bestandteile der
Ration sind gemäß Futtermitteltabellen (DLG) zu gewichten und zu
bewerten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen dass
"Verdaulichkeit" nicht wirklich bedeutet, dass die Inhaltsstoffe
vom Pferdeorganismus auch tatsächlich, in gesundheitlich
nützlicher und Körpersubstanz aufbauender Weise, aufgenommen
werden. Vielfach werden sie im Darm wieder abgebaut oder durch die
Nieren oder Haut ausgeschieden.
Hafer und Gerste sind die in unseren Breitengraden besten
und geeignetsten Getreidefuttermittel, dem folgt der (erst im
Dickdarm verdaute, und zu Koliken Veranlassung gebende) Mais mit
weitem Abstand.
Ort der Fütterung
Das "Wie und Wo" ist bei der Fütterung ebenso wichtig, wie das "was"
und "wieviel". Hierzu habe ich im Aufsatz "Pferdehaltung" einiges
geschrieben, was ich immer noch für richtig halte.
Fütterungsmengen
Im Unterschied zu den Wiederkäuern ist das Pferd kein besonders
spezialisierter Planzenfresser. Als Wildpferd
musste es wohl immer seine größere Beweglichkeit ausspielen, um
der Futterkonkurrenz des Wildrindes zu entkommen, und hatte
deshalb wohl kaum ein bequemes Leben. Sein Verdauungssystem ist
die ältere, und einfachere Konstruktion (obwohl sie, wie jeder
Pferdebesitzer weiß, sehr empfindlich ist für Störungen). Es
beruht wahrscheinlich nicht auf Zufall, dass die Widerkäuer,
evulotionsbiologisch gesehen, die erfolgreichere Tierart
sind als die Equiden. Das muß man als Pferdefreund einmal neidlos
anerkennen. Hätte der Mensch sich erst ein paar hunderttausend
Jahre später entwickelt, hätte er auf dem Planeten Erde vielleicht
keine Equiden mehr vorgefunden. In Amerika waren sie zu Beginn
historischer Zeit bereits ausgestorben, und nichts spricht dafür
dass die Indianer hieran Schuld waren. Um hierfür ursächlich zu
sein, waren sie zu der Zeit des Aussterbens der Pferde in Amerika,
eben noch über die Behringstraße aus Nordostasien
herübergewandert, einfach zu wenig zahlreich.
Fürs heutige Pferd heißt dies letztlich, dass es bezogen auf die
Grundlage der Fütterung vor allem unverdorbene Rohfaser braucht,
und ansonsten wenig anspruchsvoll ist. Das beste Futter bleibt
immer das Gras. Selbst Armeepferde, die im Frieden stets
in Ständern untergebracht waren, waren in Manöver- und
Kriegszeiten unproblematisch an Gras zu gewöhnen. Dieses vom Pferd
gefressene Gras ist schwer zu messen und zu wiegen. Im Winter
wächst es nicht viel, aber wo es auf den Winterweiden vorhanden
ist, wird man feststellen, dass auch im Dezember noch wenig Heu
gefressen wird, außer wenn anhaltender Regen oder Schnee die
Pferde zum längeren Aufsuchen überdachter Futterplätze
veranlassen.
Ein großes Problem für Pferdebesitzer ist heute oft die
Beschaffung von qualitativ hochwertigem Heu. In der
Viehwirtschaft wird aus Gründen der Arbeitsersparnis und -technik
fast nur noch Silage gemacht, und das versucht man auch auf die
Pferdehaltung zu übertragen, insbesondere in den Großbetrieben.
Anderswo stellt man den Pferden einfach einen neuen Rundballen mit
dem Traktor hin, wenn der alte aufgefressen ist. Für kleinere
Pferdegruppen ist aber die Fütterung von Kleinballen, s.g.
"Hochdruckballen", immer noch die vorteilhafteste. Im Gegensatz zu
Rundballen, mehr noch Silage- oder Heulageballen, verderben sie
nicht so schnell wenn wenig Pferde daran fressen, und sind
überhaupt meist schon hochwertiger geworben und besser
durchgetrocknet. Sie lassen sich auch leichter, zu Fuß nämlich, an
entfernte Stellen bringen. Man will ja nicht unbedingt direkt an
befahrenen und begangenen Wegen und Straßen füttern. Und mit
Traktoren fährt man die Grasnarbe der Weiden im Winter schnell
kaputt.
In einem durchschnittlichen Winter, 2013/2014 (mit 50 Schneetagen
auf 450m Höhe, aber ohne sehr tiefe Frosttemperaturen) habe ich
für zwei ausgewachsene Pferde (Arabertyp, etwa 400-450kg
Lebendmasse) etwa 65 Kleinballen Heu je Pferd verfüttert,
d.h. den Kleinballen zu 15 kg, in Summe 1000 kg je Pferd, und bei
5 1/2 Monaten Heufütterungszeit im Durchschnitt 6 kg pro
Tag und Pferd. Die Pferde hatten das Heu die ganze Zeit frei zur
Verfügung (ad libitum). Die tatsächliche tägliche Freßmenge, die
ich aufgrund meiner Fütterungsmethode genau unter Kontrolle habe
(was bei Großballenfütterung nicht so einfach ist) schwankte je
nach Witterung stark zwischen 3 und 10kg täglich. Nur in den
Monaten Januar und Februar wird fast ausschließlich Heu
gefressen. Ab März begibt man sich auf die Pirsch nach den ersten
frischen Grashälmchen. Und daneben wird noch an allem geknabbert,
was aus dem Schnee herausschaut, solange das Wetter nicht so
schlecht ist, dass man auf Ausflüge verzichtet und mehr oder
weniger am Unterstand mit der Futterraufe bleibt. Auf
Strohfütterung kann ich deshalb verzichten, obwohl ich sie in der
Boxen- und Paddockhaltung für nahezu unverzichtbar halte. Ab April
bleibt dann immer mehr Heu in der Raufe liegen.
Daneben wird aber, zumal die Pferde auch geritten werden (aber
etwas kürzer und deutlich weniger intensiv als im Sommer) Hafer
gefüttert, 2x täglich und insgesamt etwa 3-4 kg je Pferd.
Abhängig von der Arbeitsbelastung und ebenfalls vom Klima (bei
anhaltender nasser Kälte oder strengem Frost gibt es mehr). Alles
in allem, füttere ich in etwa die Mengen die der typischen
Militärration (Spohr, 1912) für "leichte
bis mittlere Arbeitbsbelastung" (entsprechend DLG Empfehlungen)
entsprechen.
Stroh füttern ?
Wer sein Pferd in der Box oder Sandauslauf überwintern lässt,
muss für sinnvolle Beschäftigung des Pferdes durch Fressen sorgen.
Wer nun wesentlich mehr Heu füttert (bis zu 10kg/Tag wird hier
empfohlen, das halte ich allenfalls für große Warmblüter für
richtig), bekommt leicht Probleme mit der Beschaffung einer
entsprechend hochwertigen Menge. Außerdem werden die Pferde von
zuviel Heu auch zu fett und kurzatmig, fangen leicht an zu husten
und sind im Frühjahr nur mühsam wieder aufzutrainieren. Der
teilweise Ersatz von gutem Heu durch Futterstroh (besonders
Haferstroh) ist hier sehr hilfreich. Das Fressen von Stroh, auch
in scheinbar großen Mengen, hat überhaupt keine Nachteile.
Strohfresser haben, wie es so schön heißt, "keine Nerven", d.h.
gut ernährte Nerven, und gute Strohfresser sind niemals nervös.
Stroh macht im Unterschied zu Heu auch niemals fett. Gutes Stroh,
und rohfaserreiches Raufutter überhaupt, ist auch für die
Erhaltung und Aufbau von Sehnen und Knochen sehr gut, viel besser
als die meisten hierfür speziell verkauften Zusatzfuttermittel.
Ganz gewiß ist es hochgrad artwidrig und zu psychischen Unarten,
Aggressionen, Magengeschwüren u.ä. Veranlassung gebend, Pferde in
Boxen- und Paddockhaltung, wie man das häufig sieht, tagsüber hungern
zu lassen, insbesondere wenn dann noch auf die Stroheinstreu
verzichtet, weil man möglicherweise Probleme mit der
Mist-Entsorgung hat!
Eindecken vermeiden
Ich muß noch hinzufügen, dass ich außer bei anhaltend nasskalten
Winterstürmen, wenn meine Pferde also ganz jämmerlich zu frieren
anfangen, was nur sehr selten vorkommt, sie nicht eindecke (ausgenommen
sind sehr alte Pferde, die häufiger, aber auch nicht dauerhaft
eingedeckt werden). Dewegen müssen sie auch mehr Wärme
produzieren, und brauchen demzufolge auch mehr Futter, als
diejenigen die oft eingedeckt sind. Trotzdem fressen meine Pferde
nicht mehr, als die genannten Mengen. Ihnen ist dabei herber
Frost, wobei es meist auch sonnig und trocken ist, auch wenn sie
dann im Futter deutlich stärker zulangen, viel lieber als
Temperaturen von 0-5°C mit viel Nässe. Ich glaube aber, dass die
Temperaturanpassung der Haut und des Fells beim nicht eingedeckten
Pferd auch auf Dauer besser funktioniert, die Talgdrüsen und
entsprechenden natürlichen Funktionen weniger verweichlicht
werden, als bei denen die im Winter nur mit Decken herumlaufen.
Vor 35 Jahren ritten wir die Isländer viel schärfer, als das heute
üblich ist, und stellten sie oft mehr oder weniger nass auf die
Koppeln. Decken waren unbekannt, und keins der Pferde hustete.
Heute reite ich im Winter selbstverständlich so, dass die Pferde
fast trocken nach Hause zurückkommen. Ich habe aber Araber mit
relativ feinem, gut trocknenden Fell. Mit Isländern könnte das
schwierig werden. Hustende Pferde sind fast immer eingedeckt. Da
kann man nun fragen, was zuerst da war, die Decke oder der Husten.
Wenn meine eigenen Pferde mal husteten, was zum Glück selten
vorkam, hat ihnen nie geholfen wenn ich sie eingedeckte, und auch
die Medikamente nur sehr wenig. Wirklich geholfen hat dann immer
erst die Frühjahrssonne, Wärme, freie Bewegung und vorsichtiges
Reiten.
Liegen die Pferde auch ohne Stroh?
Spätestens, sobald man Pferde auch zu Leistungen heranzieht,
möchte man sie so halten, dass sie sich nach der Anstrengung auch
optimal erholen können. Ich habe gefunden, dass das
Liegeverhalten erwachsener Pferde hochgradig von individuellen
Vorlieben und Eigenheiten geprägt ist und auch vom Lebensalter
abhängt. Pferde im Wachstum legen sich noch relativ häufig hin,
Fohlen liegen sehr viel. Die meisten echten, ausgewachsenen
Leistungspferde gehören einem Typ an, der vergleichsweise wenig
liegt und wenig Liegezeit benötigt, jedenfalls solange sie nicht
zu alt und auf den Beinen noch gesund sind. Diese Pferde neigen
auch dazu, sich eher bei gutem, trockenem Wetter hinzulegen als
bei Nässe, oder bei Nässe kürzer zu liegen. Trockenes Stroh
motiviert sie vielleicht kurfristig zum hinlegen und wälzen, aber
nicht unbedingt zum liegenbleiben.
Pferde auf genügend großen Winterweiden suchen sich meist die
geeignetsten und trockensten Plätze aus, gern auch unter Bäumen,
um sich dort regelmäßig hinzulegen. Insbesondere in den sonnigen
Vormittagsstunden (in der Nacht wird vorwiegend gefressen).
Meistens legen sie sich aber auch in nasses Gras, wenn auch
vielleicht nicht so lange. In frisch gefallenen Schnee legen sich
fast alle Pferde gern, wenngleich sie wegen der aufsteigenden
Bodenkälte hier meist weniger lang ruhen als auf Stroh, das als
Bodenisolierung besser ist, falls dick genug eingestreut. Ich
finde fast täglich Spuren an meinen Pferden, die ein Hinlegen
bezeugen. Sie ziehen sich auch das Heu aus der Tiefraufe heraus,
um es vom Boden zu fressen und sich damit im Unterstand ein "Bett"
zu bauen.
Wo sich Pferde im allgemeinen am wenigsten gern hinlegen,
sind die eigenen Exkremente und auf feuchten Stallboden ohne
Stroh, besonders wenn dieser noch aus Beton besteht. Deswegen
halte ich Gummimatten im Stall für ebenso fehlerhaft und
auf lange Sicht gesundheitsschädlich, wie die in früheren
Jahrhunderten oft aus Sparsamkeit praktizierte Herausnahme der
Einstreu über Tag. Es gibt Untersuchungen die klar belegt haben,
dass die Liegezeiten der Pferde auf Stroh statistisch relevant messbar
länger sind wie in einstreulosen Ställen.