WANDERREITEN - die
andere Krone der Reiterei
Frank
Mechelhoff -Wanderrittführer
VFD
 ..Wanderreiten
im Taunus und drum herum... ..Wanderreiten
im Taunus und drum herum...
<-
Link
zum
Besten Wanderreitpferd von allen...
zurück zum Teil 3
(Vorbereitung des Reiters)
Teil 4: SÄTTEL beim Wanderreiten
Das Thema Sättel hängt stark mit dem Thema "Reitweise"
zusammen, das wie ich finde, in einem Buch übers
Wanderreiten kein größeres Kapitel verdient, weil man das in
speziellen und sehr guten Büchern nachlesen kann. Statt mich
länger übers Western-, Englisch- oder Camarguereiten im
Detail auszulassen (wozu ich mich gar nicht kompetent fühle)
möchte ich nachher auf die Prinzipien der Hilfengebung beim
Wanderreiten eingehen, die man aus jedem der genannten Stile
verwirklichen kann. Jeder Reiter weiß dass es Sättel gibt,
die eine bestimmte Reitweise mehr oder weniger nahelegen.
Viele solcher Sättel haben bestimmte Vorzüge, die auch beim
Wanderreiten zur Geltung kommen können. Ich gehe auch davon
aus, dass der Wanderreitsattel auch der Alltagssattel ist.
Das ist schon deshalb notwendig weil das Pferd an den Sattel
soweit gewöhnt sein muss dass es keinen Druck gibt wenn er
über mehrere Stunden, tagelang auf seinem Rücken liegt.
Allgemeine Anforderzungen an den Wanderreitsattel
Die Anforderungen an einen guten Wanderreitsattel sind: (Kriterienkatalog)
- Er muß eine gute
Passform und große
Auflagefläche zum Pferderücken hin haben, um
nicht nur das Reitergewicht gut zu verteilen sondern
auch das des Gepäcks
- Anpassbarkeit: Er
muß sich bei Formänderungen des Pferdes (Wachstum,
Training etc.) durch einen Sattler verhältnismässig
leicht ändern lassen, evtl. auch durch den fachkundig
gemachten Reiter selbst
- Flexibilität: Nach
Möglichkeit soll nicht nur der Baum sondern auch die
Trachten sich den Bewegungen des Pferdes anpassen, aber
nur "leicht" ohne durchzubiegen oder zu scheuern. Dabei
sollte man berücksichtigen dass die meisten Holzbäume
und -trachten von sich aus eine gewisse Flexibilität
mitbringen, auch wenn man sie nicht sieht. Das ist auch
bei manchen Hartkunststoffen der Fall aber nicht bei
allen. Hier stellt sich dann das Problem der Ermüdung
ein was bei Stahl und Holz in geringerem Maß auftritt.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken dass es einen
baumlosen Sattel der konventionell gebaute in der
Anpassung übertrifft, noch nicht gibt und wahrscheinlich
auch nicht geben kann
- die Materialien sollen keinen Wärmestau im
Pferderücken verursachen (gute Wärmeleitfähigkeit) Dazu gehört die
Forderung nach guter Belüftung des Wirbelsäulenbereichs
- Stabile
Vorrichtungen zum sicheren Befestigen auch
schweren Gepäcks müssen vorn und hinten vorhanden sein
- Es sollte ein erprobtes
Gepäcksystem vorhanden sein dass auf diesen
Sattel angepasst ist. Falls das nicht der Fall ist, oder
das System dem Reiter nicht zusagt, sollen die
Befestigungen so ausgeführt sein dass handelsübliche
oder von einem Sattler gefertigte normale Ledertaschen
leicht passend gemacht werden können
- Er soll einfach
aufgebaut, robust, in Teilen austauschbar,
witterungsbeständig, reparaturfreundlich (auch
unterwegs) und leichtgewichtig
sein
- Er soll eine gängige Reitweise unterstützen und den
Reiter vom Sitz nahe
ans Pferd bringen und bequem sein
- Das Preis-/ Leistungsverhältnis soll stimmen.
Beim näheren Betrachten dieser Forderungen zeigt sich dass
sich viele nur auf Kosten anderer realisieren lassen, was
für den Interessenten eine schwierige Produktauswahl mit
sich bringt, wobei er aber seine eigenen Kriterien anwenden,
und die für sich und sein Pferd beste Lösung finden
kann/muss

Geeignete Wanderreitsattel-Typen (Auswahl)
Um hier keine Werbung zu machen möchte ich einen Sattel
vorstellen den es im Reitsporthandel schon lange nicht mehr
gibt, obwohl er als Wandereitsattel in Deutschland den
Referenzsattel darstellt mit dem sich alle anderen
vergleichen lassen müssen: Der Deutsche Militärsattel, in riesigen
Stückzahlen produziert, von Rekruten und Reitschülern
gehasst, in der "schrecklichen pferdelosen Zeit" von
1955-1975 in Kammern verstaubt, von Wanderreitern für
kleines Geld wiedergefunden, gepflegt und geliebt... und
Vorbild für unzählige "neue" Wanderreitsättel aus
Deutschland, Italien und selbst den USA.
Für ein anderes wichtiges Modellvorbild, heute aber
veraltet, ist der Sattel der US-Kavallerie, der McClellan
aufgeführt.
Deutscher Armeesattel (Modell
25)
Es handelt sich um einen modular auf rohhautbespanntem
Holz-Stahlskelett aufgebauten großer Trachtensattel von
9.5kg Gewicht der in 5 Größen hergestellt wurde. 1 passt für
Isländer, 2 für Araber, 3 für kleine und normale Warmblüter.
Die Trachtenkissen sind wie Sitz und Sattelblätter
abnehmbar, roßhaargepolstert und stoffbespannt
Für den heutigen Reiter ergibt sich nach obigem
Kriterienkatalog folgende Bewertung:
- ++++ (wegen der einfachen, schlecht auf
Gleichmässigkeit zu kontrollierende Füllung der Polster
keine fünf)
- ++++ (einfach zu ändern, aber nicht jede gewünschte
Form realisierbar)
- ++ (Bauweise Holz-Stahl-Rohhaut: gering
flexibel)
- +++++ (stoffgepolsterte Sitzkissen
wahrscheinlich beste Lösung, breiter Tunnel)
- ++++ (sehr stabil, aber unterschiedliche
Detaillösungen für Truppenteile und Umbauten existieren)
- ++++ (das Gepäcksystem ist vorhanden und sehr
gut, aber groß, schwer zu finden, und teuer)
- +++ (ein 60 Jahre alter Sattel ist heute leider
nicht mehr so robust wie zu Neuzeiten, dann hätte er 5
Sterne verdient, aber modular aufgebaut und leicht
restaurierbar. Das Gewicht ist immer noch OK)
- + (nicht die Stärke dieses Sattels)
- +++ (es werden noch ganz gute Stücke gehandelt,
die Schnäppchenpreise sind allerdings lange vorbei)
Einen unabhängig durchgeführten (nicht gesponsorten) Wanderreitsatteltest
in Sinne eines Erfahrungsberichts und Gegenüberstellung
finden Sie auch bei mir. Hier wird auf das Thema "Passform"
näher eingegangen.

Zäumung und Zaumzeug
Die Devise ist, möglichst wenig Leder am Pferd, und Metall
in Maul. Es ist gut wenn das Pferd noch ohne größere
Behinderung damit fressen kann. Die Anzüge einer Kandare
sollten recht kurz sein damit sie nicht schärfer als nötig
ist oder irgendwo hängenbleiben und verkanten kann. Extrem
kurze Anzüge sind auch zu vermeiden, weil von der Wirkung
her zu "schnell" (kurzer Zügelzug= hohes Drehmoment) und
unkontrollierbar. Es ist sehr gut wenn die Schenkel einer
Kandare beweglich sind. Die Zungenfreiheit sollte zum Pferd
passen. Zu einer Kandare gehört eine gute Kinnkette (am
besten die deutschen mit breiten Gliedern die normalerweise
keine Scheuerstellen verursachen).
Für nicht "kandarenreife" Pferde empfiehlt sich eine gute
doppelt gebrochene Trense (KK Ausbildungsgebiß) die es heute
in allen Breiten und Stärken zu kaufen gibt.
Als Kopfstück dient ein gutes Lederkopfstück mit Einohr-
oder einfachem Stirnriemen ohne Kehlriemen. Beste
Erfahrungen habe ich mit den spanischen Lederzaumzeugen -
bloß die Schnallen rosten.
Als Zügel kann dasselbe Leder dienen oder auch eine
Segelschotleine aus Baumwolle falls man die noch bekommt.
Besonders Kandarenzügel sollen und dürfen schmal und fein,
müssen aber trotzdem noch griffig sein. Etwas längere Zügel
sind nützlich. Zierliche Messingkarabiner an beiden Enden,
so kann man den Zügel auch "eben mal schnell" zum Anbinden
ins Halfter oder Halsriemen klicken - natürlich nur für
solche Reittiere die solch vertrauensvolle Behandlung zu
schätzen wissen und nicht gleich anfangen Zugtests zu
veranstalten...
Halfter/ Halsring
Wie beim Zaumzeug, sollte den ganzen Tag nichts am Pferdekpf
sein was (bei evtl. schweisstreibender Arbeit)
Scheuerstellen verursacht oder auch nur mehr als ein
unvermeidbares Unwohlgefühl. Meine Pferde z.B. stehen auch
nicht gern mit Halfter auf der Koppel - außer der Isländer,
dem ist es egal. Man sollte das nehmen was individuell am
besten vertragen wird. Ich habe eine sehr lange Zeit
Strickhalfter bevorzugt weil sie weniger scheuern, finde
aber mittlerweile im Reitsporthandel keine qualitativ
hochwertige mehr. Für ein absolut anbindesicheres Pferd ist
ein Knotenhalfter (Typ Parelli) eine ganz feine und edle
Sache, aber als 100%
hütesicher würde ich das nicht ansehen.
Zwar nicht hübsch aber praktisch, und auch von
hautempfindlichen Pferden akzeptiert werden lederne Halsringe.
Viele scheinen es der Anbindung am Kopf deutlich
vorzuziehen. Man kann sie auch beim Reiten dranlassen.
Knoten- und Nylonhalfter reiben leider oft unter Trensen.
Die Idee eines "Marschhalfters" aus kombinierter Trensen-,
Kandarenzäumung und Stallhalfter scheiterte wohl am Aufwand
und der Fülle an (zu pflegenden, scheuerndem) Leder. Gut war
die Idee an sich ja schon. Wem es auf Optik gar nicht
ankommt, kann natürlich auch ein Tresengebiß in ein Halfter
schnallen. Allerdings ist damit die Trensenführung kaum
präzis einzustellen. Und die Schnallerei dürfte kaum
schneller gehen als Auf- und Abtrensen eines kehlriemenlosen
leichten Kopfstücks. Die Kopfstücke mit Kehlriemen kommen
einer sicheren Quelle zufolge aus der Militärreiterei und
wurden dort verwendet weil die Kelhlriemen es dem Pferd
unmöglich machen das Kopfstück auszuziehen, wenn der
zufußgehende Reiter es an den Zügeln hinterher zieht. So
etwas soll man ja sowieso nicht machen; aber wenn man ein
Kopfstück ohne Kehlriemen hat, sollte man das mit bedenken.
Vielleicht haben es diejenigen besser die gebißlos reiten.
Allerdings verursachen gebißlose
Zäume auch oft Scheuerstellen, besonders auf der
Nase. Man kommt oft nicht umhin sie nicht so arg sensibel
und damit hautschonend anwenden, denn STOP ist nun mal
STOP!... Außerdem benötigen viele Pferde bei mehrstündigen
Ritten einfach ein Gebiß um sie "über den Rücken" gehen zu
lassen, wenn der erste Schwung verflogen ist. Ein ermüdetes
Pferd ohne Gebiß welches sich auf die Hand legt ist eine Qual für den
Reiter, und kann bald Überlastungsschäden der Vorhand
erleiden.
Ich habe im übrigen große Achtung vor Reitern die ihre
Pferde in exzellenter Haltung über viele Stunden gebißlos
reiten können, bezweifle aber dass es viele gibt die dazu in
der Lage sind.

WANDERREITAUSRÜSTUNG
Nach den vorhin besprochenen Typen von Wanderritten ist
vielleicht klar, dass es "die" optimale Ausrüstung
eigentlich nicht geben kann, sondern immer nur eine am
besten zum Typ des Wanderritts und der Reitweise des Reiters
passende. Ich will auf dieser
Seite eine spezielle für den Typ Biwakritt beschreiben,
weil es mir als die anspruchsvollste, außergewöhnlichste und
von dem was jedes Reitsportgeschäft bietet, am meisten
unterschiedliche erscheint, und hier außerdem hier die
Ausrüstung den Freiheitsgrad am meisten unterstützt, oder
einfacher formuliert, die Ausrüstung zu den entscheidenden
Faktoren dazugehört, was bei gewöhnlichen Ritten nicht der
Fall ist.
Man kann falsch
verstandenen Perfektionismus so weit treiben dass
er die Aktivität behindert. Mir ist es auch schon passiert
dass ich zwei Tage lang gepackt habe, weil ich erst alles
zusammensuchen, manches noch säubern und reparieren, und
einige Teile die fehlten oder defekt waren noch nachkaufen
mußte. Nie wieder!
Seitdem bemühe ich mich, bereits beim letzten Einpacken auf
dem Ritt oder gleich nach Ankunft zuhause trotz Müdigkeit
alles so vorzubereiten dass ich gleich wieder losreiten
könnte. Fast alles ist in 60l-Alu-Kisten verpackt und muß
nur ins Auto geladen werden und es kann sofort wieder
losgehen - wenn's sein muss Freitagabend gleich nach der
Arbeit!
Nötig und unnötig
Ich finde es oft amüsant nachzulesen was alles als
Wanderreitausrüstung angeboten wird. Es gibt indes eine
hervorragende Schule notwendige und nicht notwendige Teile
zu trennen, und das ist die Praxis. Auf meinen Wanderritten
wird nahezu jeder Ausrüstungsbestandteil täglich verwendet,
sämtliche Taschen jeden Tag einmal leergeräumt. Die einzige
Ausnahme von der Regel sind das Beschlagwerkzeug, die
Apotheke und der Kleidersack. Auch hier ist eine sinnvolle
Beschränkung angebracht: ein Pulli, eine Jacke reichen fast
im ganzen Jahr. Unterwäsche und Socken kann man unterwegs an
einem Rasttag auch einmal waschen (sich selbst ebenfalls)
Mit einem Troßfahrzeug gilt diese Beschränkung
natürlich nicht.
Es gibt noch einen weiteren Test. Es kommt vor dass man
Dinge verliert oder
im Quartier vergisst.
Das muss noch nicht Zeichen von Alzheimer sein, wenn man
bedenkt dass so eine Ausrüstungsliste 90-120 Positionen
umfassen kann. Wenn man es aber erst nach einer halben
Stunde Ritt bemerkt, und nicht selbst bereit ist
zurückzulaufen und es zu holen - denn was kann das arme
Pferd dafür dass es die Strecke dreimal gehen soll? - soll
man es auf die Verlustliste des Wanderritts setzen und
baldigst vergessen.
Bestes Mittel gegen
vergessene Gegenstände ist keine Checkliste sondern
eine strenge Ordnung beim Packen, immer dieselben Handgriffe
- und gegen langes Suchen, kleine Dinge strikt zusammen mit
großen aufzubewahren mit denen man sie gemeinsam braucht,
und auch bei eiliger Benutzung nicht zu zerstreuen. In unordentlichen
Bauernscheunen liegen die Hinterlassenschaften von so
manchem Wanderritt...
Gegen Verlieren unterwegs (ebenfalls eine schwer ausrottbare
Krankheit) hilft nur sorgfältiges,
bombensicheres Packen und Blickkontrolle bei jedem
Halt und Aufmerksamkeit aller
Mitreiter. Ein vom Sattel auf den Weg gefallenes Seil müsste
jedem nachfolgendem Reiter auffallen wie ein verlorenes
Eisen.
Gegen beide Übel hilft noch Vermeiden von Außenverpackungen.
Ich meine damit die Dinge die noch irgendwie "außen"
befestigt werden müssen weil sie in die Satteltaschen nicht
mehr hineingehen. Doch was will man machen wenn sie mit
müssen? Und zu jedem Griff nach der Trinkflasche, Pulli oder
Regenjacke anzuhalten und die Taschen zu öffnen ist ja auch
nicht gerade praktisch. Auch mein Anbindeseil habe ich meist
außen, auch weil es morgens meistens nass ist. Mit dem außen
angebrachten Faltgrill stehe ich aber notorisch auf
Kriegsfuß. OK, er ist ein kleines Stück "Luxus" und
Lagerfeuerromantik wie die Blechtasse. Notwendig sind sie
beide nicht... Für manch anderen mag die Machete diesen
Zweck erfüllen. Sie ist immerhin nützlich Kokosnüsse zu
spalten die man im Supermarkt bekommen hat, oder Brennholz
fürs Lagerfeuer zuzubereiten. Besser wäre dazu allerdings
eine einklappbare Säge. Die liegt bei mir allerdings im
Auto...
Hufbeschlag
Heute ist es typischerweise nicht mehr möglich
einen Wanderritt von mehr als 4-tägiger Dauer ohne Hufschutz
zu machen. Trotzdem sollte man beim Pferd mit dem Beschlagen
möglichst spät anfangen und im Training soviel wie möglich
unbeschlagen reiten, vor allem (in Regionen mit häufigem
Schneefall) über die Wintermonate. Das Wort der Alten vom
Beschlag als einem "notwendigen Übel", das man auf ein
notwendiges Maß beschränken sollte, gilt weiterhin und in
jeder Hinsicht.
Der Hufbeschlag zum Wanderreiten muß vor allem leicht,
haltbar und strapazierfähig sein, guten Griff bieten und
wenig rutschen. Diese Anforderungen sind teilweise
komplementär und es kann immer nur Kompromisse geben. Auch
ist jedes Pferd unterschiedlich und verträgt nicht alle
Arten Beschlag gleich gut.
Kunststoffe erfüllen die ersten Kriterien sehr gut, sind
aber für Pferde ab 500kg und unregelmässigem Hufabrieb, oder
solche die schon unbeschlagen schlecht gehen eher
ungeeignet. Generell rutschen sie leicht, besonders auf Gras
oder Felsboden (am schlimmsten wenn sie feucht sind).
Man muß wissen was für ein Geläuf einen auf dem Wanderritt
erwartet, und den Beschlag entsprechend einrichten. Für
lange Ritte auf anspruchsvollem Boden zur Sommerzeit, auch
um felsige und gefährliche Passagen meistern zu können, sind
mir Profileisen am liebsten die im Zehen- und Eckbereich zum
Einschlagen von Widiastiften abgeflacht sind. Diese
Beschläge sind haltbar, relativ leicht und gut rutschsicher.
Deshalb sollte man auf Asphalt mit ihnen nicht traben.
Genügt diese Art von Gleitschutz nicht, muss man zu
(Einschraub-) Stollen greifen. Mit denen muss auf harten
Böden noch vorsichtiger geritten werden. Auf kurzen Ritten
in felsige Gegenden habe ich mit Alubeschläge (breite Stege,
in der Zehe eingelassener Griff) excellente Erfahrungen
gemacht. Jedoch ist die Lebensdauer nur halb so lang wie
beim gleichbreiten Eisen-Eisen.
Bezüglich Hufeinlagen gibt es schon immer verschiedene
Ansichten unter den Reitern. Heutzutage werden von
Distanzreitern viel Kunststoffeinlagen mit Silikonfüllung
verwendet, besonders wenn auf steinigem Boden geritten wird.
Für den Wanderreiter dürfte dies unnötig sein, da er bei
steinigem Boden langsamer reitet. Außerdem ist die
Haltbarkeit über Wochen und viele KM fraglich, desgleichen
das Gewicht und die Frage der Wärmeabführung, da die
Hufsohle nicht mehr atmen kann. Besser dürften da wohl die
traditionellen Lederplatten mit Wergfüllung sein, jedoch
können sich auch hier Eisen lockern, die Füllung
herausfallen, sich Steinchen festsetzen und Huflahmheit
verursachen u.v.m. Ein guter Kompromiss scheinen die
netzartigen Kunststoffplatten ohne jede Füllung sein.
Hinreichend stabil für felsigen Boden sind sie. Ritte bis
700km Länge haben sie bei mir durchgehalten. Bei allen
Einlagen ist zu beachten, dass ihre Verwendung aufs absolut
notwendige reduziert werden muß, da sie die Hufsohle
verweichlichen und auf lange Sicht druckempfindlich machen,
was dem Prinzip des Trainings zuwiderläuft. Der Satz "Wenn
einmal Platten, dann immer" bringt das auf die knappe
Formel. Gerade so soll es ja nicht sein!
All diese Sonderbeschläge sind schwieriger herzustellen bzw.
anzupassen als gewöhnliche, und nicht jeder Schmied hat das
Material auf Lager. Daher ist es gut, sich schon früh mit
seinem Schmied über das geplante Vorhaben zu besprechen,
zumal er am besten beurteilen dürfte wie das betreffende
Pferd zu beschlagen ist. Der angehende Wanderreiter ist
übrigens bestens beraten jedes Mal beim Beschlagen
seines Pferdes selbst aufzuhalten. Beim Beobachten und den
hierbei sich ergebenden Gesprächen gibt es unendlich viel zu
lernen. Er sollte ferner das Entfernen von Eisen, das
Ersetzen eines Nagels sowie das Neubefestigen eines
vorhandenen Eisens in die alten Löcher unter Anleitung üben,
da er es früher oder später auf einem Wanderritt brauchen
wird, und diese Arbeiten am besten und schnellsten sogleich
bei Notwendigkeit verrichtet werden, und nicht erst das
Pferd auf drei Hufeisen weiterreiten, bis evtl. ein
regulärer Hufschmied gefunden ist.
Er sollte Notbeschlagswerkzeug
mitnehmen, um diese Handgriffe ausführen zu können. Ich
empfehle die SCHRÄDER-Zange oder die italienische TOT-ONE
(kann der Hufschmied besorgen). Ich selbst bin jahrelang mit
frischem Beschlag
ohne jedes Werkzeug aufgebrochen. Ersteres ist sehr
zu empfehlen - letzteres nicht. Aus eigener Erfahrung kann
ich sagen: irgendein Hammer
und irgendeine Zange
bekommt man immer geliehen, auch wenn es mit Spezialwerkzeug
(auch dem Notbeschlagswerkzeug) wesentlich besser geht. Was
man garantiert nirgendwo bekommt sind Hufnägel.
Einmal (1996) verlor meine Stute Ligeira nach 320 von 400km
ein Vordereisen. Ich musste mir Werkzeug leihen und richtete
das verbogene Eisen auf einem Stein. Danach klopfte ich die
schon sehr abgelaufenen, durch das Abtreten
korkenzieherartig verbogenen Hufnägel gerade (!) und schlug
das Eisen wieder auf, unter Verzicht auf die dicke
Lederplatte, wodurch ich die erforderliche Freiheit zum
Umnieten gewann. Das Eisen hielt zuhause noch 2 Wochen.
Wiederholen möchte ich das Prozedere nicht, wenn ich es
vermeiden kann. In der abgelegenen Region wo dies passierte
hätte mich Herumtelefonieren und Warten auf den Hufschmied
sicher einen Reisetag gekostet. Weiteres
zum Thema Hufschutz und Hufbeschlag habe ich hier
beschrieben.
- weiter mit Teil 5
-
|
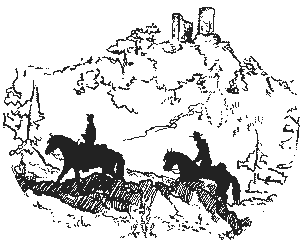
 yahoo.de
yahoo.de


